-
Halkyonische Tage

Halkyonische Tage – Bedeutung und Herkunft der Tage des Glücks und der Ruhe
Als "Halkyonische Tage", auch Halkyonische Periode, bezeichnen wir glückliche Tage voll Frieden und Ruhe.
Herkunft
Seine Herkunft geht zurück auf eine griechische Sage, in der sich die Frau eines Seefahrers namens Halkyone ins Meer stürzt, nachdem sie erfährt, dass ihr Mann auf einer Seefahrt umgekommen ist.
Gerührt von diesem Liebesbeweis verwandelten die Götter das Paar in Eisvögel, die ihre Brutzeit zur windstillen Zeit der Wintersonnenwende haben. In einer Legende über Eisvögel (auch als Halkyon bezeichnet) beruhigt der Eisvogel das Meer während dieser Zeit, um ungestört seine Eier auszubrüten.
Bedeutung
"Halkyonische Tage" verwenden wir heute metaphorisch, um eine Zeit der Ruhe, Harmonie und Gelassenheit zu beschreiben.
-
Heureka – Herkunft

Heureka! Bedeutung und Herkunft des Ausrufs
Der Ausruf "Heureka" verdankt seine Herkunft einer Anekdote um den griechischen Mathematiker Archimedes, der im 3. Jahrhundert vor Christus in Syrakus lebte.
Er soll das Prinzip des Auftriebes beim Baden entdeckt haben und anschließend nackt durch Syrakus zum König gelaufen sein und immerfort "Heureka!" gerufen haben, was so viel bedeutet wie "Ich habe es gefunden!"
Heutige Bedeutung: "Heureka!" ist nach wie vor ein Ausruf der Freude nach Lösung eines schwierigen Problems oder bei einem triumphalen Aha-Moment.
-
Ich wittre Morgenluft – Bedeutung

Ich wittre Morgenluft – die Chance riechen – heutige Bedeutung
Seine Herkunft verdankt die Redensart "Ich wittre Morgenluft" einer Schlegel-Tieck-Übersetzung aus Shakespeares Hamlet (I,5).
Sie geht zurück auf den Ausspruch des Geistes von Hamlets Vater "But soft! Me thinks I scent the morning air" (Doch still, mich dünkt, ich wittre Morgenluft).
Bei Shakespeare ist der Ausdruck wörtlich gemeint, da der Geist bei Anbruch des Tages verschwinden muss.
Heutige Bedeutung: Wir verwenden heute den Ausspruch "ich wittere Morgenluft" in übertragener Bedeutung und meinen, dass wir "die eigene Chance wittern" oder "für ein Vorhaben einen günstigen Verlauf voraussehen".
-
Ins Fettnäpfchen treten – Bedeutung und Beispiele

Das hinterlässt keine schönen Spuren
Ins Fettnäpfchen treten – Bedeutung und Beispiele
Herkunft
Seine Herkunft hat die Redewendung "Ins Fettnäpfchen treten" auf den Brauch in Bauernhäusern, meist in der Nähe des Ofens, ein Topf mit Stiefelfett aufzustellen. Dieser diente den Eintretenden dazu, sich umgehend die nassen Stiefel einzureiben. Wenn nun versehentlich jemand in den Topf mit dem Fett trat und Flecken auf den Dielen machte, verärgerte er die Frau des Hauses.
Eine weitere Variante der Erklärung soll der Brauch sein, einen Napf auf den Küchenboden zu stellen, damit das herabtropfende Fett von zum Räuchern aufgehängten Würsten und Schinken aufgefangen wird. Auch hier war der Tritt ins Näpfchen nicht von Vorteil.
Heutige Bedeutung
Wenn wir heute "ins Fettnäpfchen treten", dann haben wir, durch eine ungeschickte Handlung oder durch eine unglückliche Äußerung, jemanden verärgert bzw. seinen Unwillen erregt.
-
Kaiserwetter – Bedeutung

Kaiserwetter – Bedeutung, Herkunft – Traumwetter für alle
Die Herkunft dieser Redensart geht zurück auf den deutschen Kaiser und preußischen König, Kaiser Wilhelm II (1859 - 1941).
Zu jener Zeit benötigte man film- und mediengerechtes Wetter, um in den Massenmedien zu "glänzen". Selbst kurzfristig wurden Termine abgesagt, wenn das "Kaiserwetter" ausblieb.
Heutige Verwendung: "Kaiserwetter" wird heute sprichwörtlich für strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel verwendet.
Der Begriff "Kaiserwetter" wird auch in Verbindung mit bestimmten Regionen genannt, die für ihr besonders sonniges und trockenes Klima bekannt sind, wie zum Beispiel Südtirol. In manchen Gegenden wird der Begriff aber auch für sehr kaltes Wetter verwendet, das aber dennoch sonnig und klar ist.
-
Landgraf, werde hart!

Landgraf, werde hart! – Bedeutung und Herkunft – nur die Harten kommen in den Garten
Herkunft
Seine Herkunft verdankt diese Redewendung einer Sage von Johannes Rothe. Er berichtet vom Landgraf Ludwig von Thüringen (1140 - 72), der anfänglich so milde geherrscht haben soll, dass die Mächtigen im Lande übermütig wurden und das Volk ausbeuteten und quälten.
Während eines Jagdausfluges verirrte sich jener Landgraf und fand bei einem Schmied im Thüringer Wald Unterkunft. Auch dieser wurde von den Oberen aufgrund der Milde des Landgrafs ausgepresst. Der Schmied, der den Landgraf nicht erkannte, habe, während er nachts immer wieder auf seinen Amboss schlug, auf die Lässigkeit des Grafen geflucht und mit jeden Schlag gefordert: "Nun werde hart". Immer wieder soll er geklagt haben: "... du böser, unseliger Herr! Was taugst du den armen Leuten zu leben? Siehst du nicht, wie deine Räte das Volk plagen?"
Aufgrund dieses Erlebnisses soll der Landgraf alsbald für Zucht und Ordnung im Lande gesorgt haben.
Die heutige Form des Sprichworts "Landgraf, werde hart!" stammt aus Wilhelm Gerhards (1780 - 1858) Gedicht "Der Edelacker".
Bedeutung
Heutige Verwendung 1: Die Aufforderung "Landgraf, werde hart!" gilt als Ermahnung an einen allzu milden Vorgesetzten oder an eine Regierung, strenger gegen Unrecht und Missstände vorzugehen.
Heutige Verwendung 2: Wir nutzen den Ausdruck auch, um Menschen aufzufordern, sich Herausforderungen mit Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen zu stellen. Es geht darum, keine Angst vor Schwierigkeiten zu haben, sondern sich ihnen mutig zu stellen und den eigenen Weg zu gehen.
-
Löwenanteil Sprichwort

Der Löwenanteil – ein immer noch gültiges Sprichwort aus einer uralten Fabel
Zurückzuführen ist dieser Ausdruck auf die Fabel "Der Löwe, der Esel und der Fuchs" des griechischen Dichters Aesop.
Als "Löwenanteil" bezeichnen wir den weitaus größeren Anteil, den jemand erhält. Zumeist, wie in dieser Fabel, ist es der Größte oder Mächtigste, der den Löwenanteil erhält.
Herkunft des Sprichwortes: Die Fabel von Aesop
Löwe, Esel und Fuchs schlossen einen Bund und gingen zusammen auf die Jagd. Als sie reichlich Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, diese unter sich zu verteilen.
Der Esel teilte die Beute in drei gleich große Teile und forderte den Löwen auf, sich selbst einen davon zu wählen.
Da wurde der Löwe wild und zerriss den Esel in Stücke. Dann befahl der dem Fuchs zu teilen. Der Fuchs schob fast die ganze Beute dem Löwen zu und behielt nur einen kleinen Teil für sich.
Der Löwe brummte zufrieden und fragte den Fuchs: "Wer hat dir beigebracht, so weise zu teilen?"
"Der Esel", antwortete der Fuchs.
-
Morpheus' Arme - Bedeutung
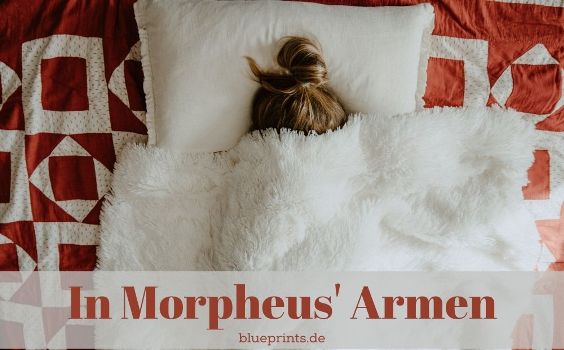
Morpheus' Arme - Bedeutung und Herkunft der Grüße vom Traumgott
Herkunft
Der Gott des Schlafes ist eigentlich Hypnos, der Sohn der Nacht. Die Redewendung "Morpheus' Arme" verdankt seine Herkunft dem Sohn von Hypnos namens Morpheus, auch als griechischer Traumgott bekannt.
Bedeutung
Wenn du heute Morgen aus "Morpheus' Armen" gerissen wurdest, dann riss man dich aus einem ruhigen Schlaf.
Morpheus' Arme = seliger Schlaf
Der Ausdruck ist in verschiedenen Verbindungen zu hören:
- Wir können in Morpheus' Armen liegen.
- Wir könnten in Morpheus' Arme sinken.
- Wir sehnen uns nach Morpheus' Armen.
Hier findest du "Morpheus' Arme" erläutert ► Beispiele der Verwendung ► Mehr zur Herkunft ► Umfrage zur Verwendung ► Synonyme zu Morpheus' Arme ► Artikel zum Thema Schlaf und Träumen ► Videos zum Thema Schlaf
-
Nichts Neues unter der Sonne - Bedeutung und Herkunft

Nichts Neues unter der Sonne – Bedeutung und Herkunft
Diese Redewendung verdankt seine Herkunft dem Buch Kohelet (oder Prediger) im alten Testament.
Kohelet ist eine weise und philosophische Abhandlung über das Leben und die Welt, zugeschrieben dem biblischen König Salomo. In Kohelet 1,9 (Lutherbibel) heißt es:
„Was gewesen ist, das wird wieder sein; was geschehen ist, das wird wieder geschehen; es gibt nichts Neues unter der Sonne.“
Ursprünglich hatte die Redensart in der Bibel eine tief religiöse und philosophische Bedeutung. Sie betonte die Vorstellung, dass die Welt von Gott geschaffen wurde und dass sich alles, was in der Welt geschieht, im Rahmen eines göttlichen Plans wiederholt. Es war eine Erinnerung an die Endlichkeit menschlicher Bemühungen und den unveränderlichen Lauf der Dinge.
Heutige Bedeutung: Wenn wir heute diesen Ausspruch nutzen, dann geben wir etwas resigniert der Erkenntnis Ausdruck, dass bestimmte Geschehnisse und Verhaltensmuster immer wiederkehren und uns nicht überraschen bzw. enttäuschen sollten.
-
Ojemine! – Herkunft

Ojemine! Herkunft & Bedeutung von O Jesus mein
Seine Herkunft verdankt der Ausruf "Ojemine" bzw. "O Jemine" kreativen Gläubigen. Als Bekundung des Mitleids, des Entsetzens oder der Überraschung hat es seinen Ursprung in der lateinischen Anrede für "Herr Jesus".
Aus "O Jesu Domine" wurde somit der Stoßseufzer "O Jemine!" oder in der Kurzform "Oje!". "O herrje(h)" entstand entsprechend aus "Herr Jesus".
Diese entstandenen Verhüllformen wurden damals in der Gesellschaft besser akzeptiert und man bekam weniger Ärger mit Kirchdienern.
Jim: "Das Meeting dauerte gestern bis 19:15 Uhr."
John: "Ojemine, da warst du ja erst spät zu Hause." -
Penelopearbeit

Penelopearbeit – Arbeit ohne Ende – Bedeutung, Herkunft
(griech., aus Homers Odyssee) Penelope war die Frau des tapferen, klugen und verschlagenen Odysseus.
Seine Herkunft hat der Ausdruck in einer denkwürdigen Handlung von Penelope. Während der Irrfahrten von Odysseus hielt sie die Bewerber um ihre Hand hin. Sie versprach ihnen Gehör, sobald sie für ihren Schwiegervater Laertes ein Totengewand fertiggewebt hätte. Nachts löste sie aber wieder auf, was sie tagsüber geschaffen hatte.
Penelopearbeit ist zu einem anderen Ausdruck für "Arbeit ohne Ende" geworden.
-
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige | Bedeutung
Bedeutung: Die Redewendung "Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige" gebrauchen wir heute, wenn es zu den Vorzügen eines Vorgesetzten gehört, auch Untergebene nicht warten zu lassen. Pünktlichkeit ist somit eine Möglichkeit sozial hochgestellter Persönlichkeiten, anderen Wertschätzung zu zeigen.
Im heutigen Sprachgebrauch wird das Sprichwort auch dahingehend verwendet, dass man der Eigenschaft der Pünktlichkeit eine hervorgehobene Bedeutung geben möchte - unabhängig vom Rang der Person, die pünktlich sein sollte.
Herkunft: Seine Herkunft verdankt das Sprichwort dem französischen König Ludwig XVIII. Dieser wird in den Lebenserinnerungen des Bankiers Jacques Laffitte folgendermaßen zitiert: "L'exactitude est la politesse des rois" also "Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige". So wollte er zum Ausdruck bringen, dass Pünktlichkeit selbst von Königen beachtet werden sollte, um so den Respekt vor seinen Mitbürgern auszudrücken. Auch Napoleon sah Zeitdiebe als eine schlimme Sorte von Verbrechern an, deren Missetaten meist ungesühnt blieben.
-
Schuster, bleib bei deinem Leisten – Bedeutung

Schuster, bleib bei deinem Leisten – die Mahnung des Apelles – Bedeutung, Herkunft
Das Sprichwort "Schuster, bleib bei deinem Leisten" hat seine Herkunft in einer Anekdote, die im alten Griechenland erzählt wurde. Nach ihr pflegte der große Maler der Antike Apelles, der zur Regierungszeit Alexanders des Großen seine Gemälde öffentlich ausstellte, sich hinter seinen Bildern zu verstecken, um die Urteile der Betrachter zu hören.
Als ein Schuhmacher laut bemerkte, dass den Schuhen auf dem Bild eine Öse fehle, fügte Apelles diese nachträglich hinzu. Aber als der Schuhmacher nun auch noch Kritik an den Beinen übte, wurde er von Apelles mit den Worten zurechtgewiesen: "Ne sutor supra crepidam!" oder zu Deutsch: "Was über dem Schuh ist, kann der Schuster nicht beurteilen!"
Die Mahnung "Schuster, bleib bei deinem Leisten" sagen wir heute zu jemandem, der ohne Sachverstand Kritik übt und sich unberufen in alles einmischt.
-
Mit fremden Federn schmücken

Sich mit fremden Federn schmücken – Bedeutung und Herkunft der Redewendung
Die Herkunft der Redensart geht auf eine Fabel des römischen Dichters Phaedrus (1,3) zurück. Hier schmückt sich eine Krähe mit Pfauenfedern und muss dies büßen.
Herkunft: Die Fabel "Mit Fremden Federn schmücken"
Eine Krähe sah auf dem Boden lauter herrliche Pfauenfedern liegen. Sie überlegte nicht lange und beschloss, ihr eigenes fades Gefieder ein bisschen aufzuhübschen. Sie steckte die schönen Pfauenfedern einfach zwischen ihr eigenes Gefieder. Stolz auf ihre neue Federpracht begab sie sich mitten in eine Gruppe von Pfauen, um sie an der neu gewonnen Eleganz Anteil haben zu lassen.
Aber ach, die fanden das so gar nicht lustig und stürzten sich auf die Krähe und rupften ihr nicht nur die fremden, sondern auch noch ziemlich viele eigene Federn aus. Als die rachsüchtigen Pfaue von der Krähe abließen, stand die Krähe gerupft und wesentlich armseliger als zuvor da. Und die Moral von der Geschichte: Mit fremden Federn schmückt man sich nicht.
Bedeutung der Redewendung
Wenn jemand sich die Verdienste anderer zu eigen macht bzw. jemand sich mit den Verdiensten anderer brüstet, dann "schmückt er sich mit fremden Federn".
Das Problem: Wenn dieses Schmücken mit fremden Federn herauskommt, steht derjenige schlechter da, als hätte er es nicht getan. Häufig haben solche "Lügen" nämlich kurze Beine und werden entdeckt. Die Führungskraft, die die kreative Leistung einer Mitarbeiterin als ihre darstellt, wird stets hoffen müssen, dass dies im Unternehmen nicht im Flurfunk veröffentlicht wird.
-
Tantalusqualen – Bedeutung
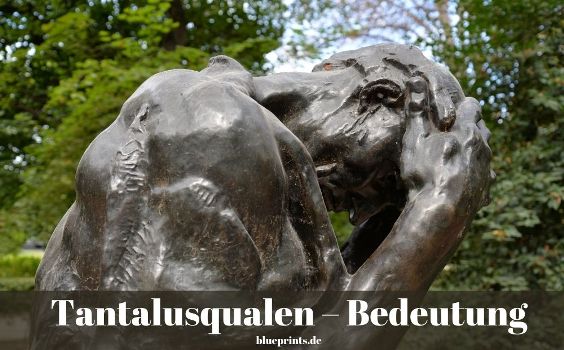
Tantalusqualen – die Rache der Götter – Bedeutung und Herkunft
Der Begriff Tantalusqualen verdankt seine Herkunft der griechischen Mythologie. Der Sohn der Titanen "Tantalos" und Stammvater des Geschlechts der Tantaliden zog den Zorn der olympischen Götter auf sich, indem er sie betrog.
Sie verurteilten Tantalos zu ewigen Qualen. Er musste in einem Teich stehen, über dem Birnenbaumzweige hingen. Jedes Mal, wenn Tantalos trinken wollte, senkte sich der Wasserspiegel. Wenn er eine Frucht pflücken wollte, wichen die Äste zurück. Zusätzlich drohte auch noch ein großer Felsbrocken auf ihn herabzufallen.
Obwohl alles in greifbarer Nähe schien, so war Tantalos doch zu ewigem Durst und Hunger verdammt.
Als "Tantalusqualen" bezeichnet man demnach die Qual, etwas Unerreichbares beständig nahe vor sich zu sehen.
-
toi, toi, toi Bedeutung Teufel

toi, toi, toi! - Schutz vor dem neidischen Teufel - Bedeutung
Der Ausruf "toi, toi, toi" ist um 1930 durch einen Schlager verbreitet worden und steht mit einem alten Volksglauben in Zusammenhang. Lobende Äußerungen wurden allgemein gefürchtet, weil diese die bösen Geister aufmerksam und neidisch machen konnten.
Um kommendes Unheil abzuwehren, musste man deshalb dem Lob sofort eine Schutzhandlung hinzufügen. Das wurde z. B. durch dreimaliges Klopfen auf Holz und den Ausruf "toi, toi, toi" vollzogen, der lautmalerisch für dreimaliges Ausspucken steht. Der Speichel galt als unheilbannend.
Das Ausspucken vor einem Menschen war also ursprünglich ein Abwehrzauber, kein Zeichen der Verachtung wie heute. Auch das zuerst eingenommene Geldstück, das noch mehr Reichtum bringen sollte, der Spielwürfel, der Gewinn garantieren sollte, wurden bespuckt. Am Theater wird der Brauch gepflegt, so den Schauspielern Erfolg für den Auftritt zu wünschen.
Aber es gibt weitere spannende Ideen zur Herkunft des Ausrufs "toi, toi, toi".
-
Zankapfel – Bedeutung

Zankapfel Bedeutung: wegen Eitelkeit einen Krieg gestartet
Seine Herkunft verdankt der Begriff "Zankapfel" der griechischen Mythologie. Er wird auch als Apfel der Eris, Erisapfel oder Apfel der Zwietracht bezeichnet.
Eris ist die Göttin des Streits und der Zwietracht. Auf einer Hochzeit soll sie einen goldenen Apfel mit der Aufschrift "Für die Schönste!" zwischen die Göttinnen geworfen haben, und zwar aus Ärger darüber, dass sie nicht eingeladen war.
Göttervater Zeus weigerte sich, den Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite zu schlichten, wem denn nun der Apfel gebühre. Zeus ließ den trojanischen Königssohn Paris die Entscheidung treffen. Dieser erklärte die Liebesgöttin Aphrodite vor Athene und Hera für die schönste Göttin (das Parisurteil), was zum Trojanischen Krieg führte.
Heutige Bedeutung
Als "Zankapfel" bezeichnen wir heute den Anlass eines Streites bzw. den Gegenstand einer Auseinandersetzung.
-
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Muttersprache | Zitat

„Alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung.“
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831), deutscher Philosoph
-
Fass der Danaiden – Bedeutung

Fass der Danaiden - eine unendliche Aufgabe als Strafe - Bedeutung und Herkunft
Die Redensart "Fass der Danaiden" verdankt seine Herkunft der antiken griechischen Mythologie. Die Danaiden sind die 50 Töchter des Königs Danaos, die zur Strafe für den Mord an ihren Ehemännern in der Unterwelt dazu verurteilt wurden, ein löchriges Fass (oder auch einen Brunnen) ewig mit Wasser zu füllen. Dieses Fass, das niemals voll wurde, steht symbolisch für eine endlose, niemals abgeschlossene Aufgabe.
Heutige Bedeutung: Mit dem Begriff "Danaidenarbeit" bezeichnen wir eine nutzlose und mühsame Arbeit.
-
Morgenstund hat Gold im Mund – Bedeutung

Morgenstund hat Gold im Mund – Bedeutung, Erklärung
"Morgenstund hat Gold im Mund" verdankt seine Herkunft der genauen Übersetzung des lateinischen Lehrbuchsatzes "aurora habet aurum in ore". Das lateinische Sprichwort bezieht sich auf die personifizierte Morgenröte (lat.: aurora), die Gold im Mund und im Haar trägt.
Das Sprichwort bringt zum Ausdruck, dass sich frühes Aufstehen lohnt, weil man am Morgen gut arbeiten kann und der Frühaufsteher mehr erreichen würden.
"Morgenstund hat Gold im Mund" wurde zuerst in einem Brief des Erasmus von Rotterdam an seinen Schüler Christian Northoff nachgewiesen. Er nutzte jedoch das lateinische Sprichwort "aurora musis amica" (die Morgenstunde ist die Freundin der Musen).
Außerdem trägt ein großartiges Gedicht des deutschen Lyriker, Erzähler und Maler Joachim Ringelnatz diesen Namen. Es geht so:
Morgenstund hat Gold im Mund
Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften. -
Wasser predigen und Wein trinken – Bedeutung, Ursprung

Wasser predigen und Wein trinken – des Heuchlers Art – Bedeutung und Ursprung
Das Sprichwort verdankt seine Herkunft dem Gedicht "Ein Wintermärchen" aus Heinrich Heines Versepos"Deutschland".
Mit dem geflügelten Wort bringen wir zum Ausdruck, dass jemand sich heuchlerisch verhält, indem er zum Beispiel Verzicht oder Genügsamkeit fordert, aber sich selbst verschwenderisch oder genusssüchtig verhält.
Hier der Ursprung des Sprichworts: das Gedicht "Ein Wintermärchen" von Heine.
Ein Wintermärchen
Sie sang vom irdischen Jammertal,
von Freuden, die bald zerronnen,
vom Jenseits, wo die Seele schwelgt,
verklärt in ewigen Wonnen.Sie sang das alte Entsagungslied,
das Eiapopeia vom Himmel,
womit man einlullt, wenn es greint,
das Volk, den großen Lümmel.Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
ich kenn' auch die Herren Verfasser;
ich weiß, sie tranken heimlich Wein
und predigten öffentlich Wasser.Heinrich Heine (1797 - 1856), einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts
-
Alles über einen Leisten schlagen – Bedeutung

Bitte immer neu vermessen
Alles über einen Leisten schlagen – Bedeutung & Herkunft
Herkunft
Die Redewendung "Alles über einen Leisten schlagen" ist seit dem 16. Jahrhundert belegt. Seine Herkunft verdankt das Sprichwort dem Schusterhandwerk. Sie bezieht sich auf die Arbeit eines schlechten Schusters, der nicht genau Maß nimmt, sondern seine Schuhe nach feststehenden hölzernen Modellformen anfertigt, den sogenannten "Leisten".
Der Leisten ist zumeist aus Holz, aber auch aus Metall. Er bestimmt später die Größe und Form des Schuhs. Der Leisten ist also eine Art Modellfuß, über den das Leder gespannt (darüber geschlagen) wird, wenn es zum Schuh zusammengenäht wird.
Bedeutung
Wenn wir heute sagen "Alles über einen Leisten schlagen", dann bringen wir zum Ausdruck, dass...
Etwas ungerechtfertigt mit dem gleichen Maßstab gemessen wird bzw. keine Rücksicht auf wesentliche Unterschiede genommen wird.
Hier findest du "Alles über einen Leisten schlagen" weiter erläutert: ► Beispiele für heutige Verwendung ► Umfrage zum Wort ► Synonyme ► Artikel zum Thema Vorurteile ► Videos zum Schuhmacherhandwerk
-
Früh übt sich, was ein Meister werden will – Bedeutung

Früh übt sich, was ein Meister werden will – Bedeutung und Herkunft
Das Sprichwort "Früh übt sich, was ein Meister werden will" ist ein Zitat aus dem Drama "Wilhelm Tell" über den schweizer Nationalhelden (1804) von Friedrich Schiller.
Wir verwenden es heute im Sinne von "je früher wir beginnen, etwas zu erlernen, desto besser."
Es bezieht sich darauf, dass jemand sich bereits in der Jugend bemühen sollte, wenn sie oder er etwas "meisterhaft" beherrschen will. Leider wird es manchmal als Entschuldigung dafür genutzt, dass man im fortgeschrittenen Alter etwas nicht mehr lernen will.
Jim: "Amelie ist 5. Sie singt jeden Tag und macht einen Tanzkurs.
John: "Ja, früh übt sich, was ein Meister werden will." -
Jemanden von Pontius zu Pilatus schicken – Bedeutung

Jemanden von Pontius zu Pilatus schicken – Bedeutung
Diese Redensart ist belegt seit 1704 und hat seine Herkunft im Neuen Testament. Auf den ersten Blick scheint die Redensart Unsinn zu sein, denn Pontius und Pilatus bezeichnen denselben Mann. (Pontius Pilatus war von 26 bis 36 n. Chr. Präfekt / Statthalter des römischen Kaisers Tiberius). Die Wendung bezieht sich auf das Neue Testament (Lukas 23, 6-11) wo berichtet wird, dass Christus von Pontius Pilatus zu Herodes und von dem wieder zu Pontius Pilatus geschickt wird.
Wenn wir heute sagen "jemanden von Pontius zu Pilatus schicken", dann meinen wir, jemanden von einem zum andern schicken oder ihn zwecklos hin- und herschicken. Zum Beispiel das nutzlose Hin- und Herlaufen zwischen mehreren Stellen auf Ämtern, Behörden etc. wird häufig so bezeichnet.
Jim: "... dann haben sie mich wieder zurück zum Zollamt geschickt."
John: "Tja, manchmal schicken sie einen wirklich von Pontius zu Pilatus." -
Etwas unter Dach und Fach bringen – Bedeutung und Herkunft

Etwas unter Dach und Fach bringen – Bedeutung
Herkunft: Aus dem Hausbau für das Leben
Die Redewendung "Etwas unter Dach und Fach bringen" verdankt ihre Herkunft dem Handwerk. Sie hat ihre Wurzeln im Mittelalter. In dieser Zeit war es von großer Bedeutung, Bauwerke vor dem Winter fertigzustellen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Wenn ein Gebäude "unter Dach und Fach" war, bedeutete dies, dass es vollständig gedeckt und somit vor Regen und Schnee geschützt war.
Das "Fach" in diesem Ausdruck bezieht sich auf das Fachwerk, eine traditionelle Bauweise, bei der ein Holzgerüst mit Lehm oder Ziegeln ausgefüllt wird. Daher kommt der Ausdruck, dass etwas sicher und geschützt ist, wenn es "unter Dach und Fach" gebracht wird.
Heutige Bedeutung
Die Redewendung "Etwas unter Dach und Fach bringen" bedeutet, dass wir etwas erfolgreich abgeschlossen haben. Dies kann sich auf verschiedene Situationen beziehen, von der Fertigstellung eines Projekts bis hin zur Sicherung eines Vertrags oder Abkommens.
Seite 1 von 4
