Helfersyndrom – Was tun? Tipps, Ursachen, Maßnahmen und Selbsttest
Du kennst sicher den Witz mit der älteren Dame, die am Straßenrand steht. Ein junger Mann kommt des Weges und hakt sich bei der Dame unter und begleitet sie über die Straße. Doch die Dame wehrt sich und zwar immer vehementer. Auf der anderen Straßenseite angekommen, geht der junge Mann seines Weges.
Eine andere Dame, die das Ganze beobachtet hat, fragt die ältere Frau: "Warum sind Sie denn so störrisch und undankbar zu dem jungen Mann gewesen? Er wollte Ihnen doch nur über die Straße helfen."
Darauf die ältere Dame: "Ich wollte aber gar nicht über die Straße."
Hilfsbereitschaft ist wichtig und wertvoll. Wenn der Wunsch zu helfen jedoch zu dominierend wird, dann wird es problematisch und das Resultat ist für die Betroffenen nicht immer komisch. Lese hier über das Helfersyndrom, seine Ursachen und Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Nutze auch den Selbsttest.

![]()
Ein Hinweis vorab: Hilfsbereitschaft ist überlebenswichtig
Bereits als Kinder starten wir damit, anderen zu helfen. Wir lernen, dass es positiv ist anderen zu helfen. Der eine mehr, der andere weniger. Sich gegenseitig zu helfen ist in einer Gesellschaft wichtig und der Kit, der uns zusammenhält und uns als Spezies erfolgreich macht.
Da sind die Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, Feuerwehrleute, Nachbarschaftshilfe bis hin zu den vielen, kleinen Hilfsleistungen Tag für Tag. Das ist mit dem Begriff Helfersyndrom nicht gemeint, kann aber in Einzelfällen der Ausgangspunkt sein, nämlich dann, wenn das "anderen Menschen helfen" zu einer Sucht wird und damit häufig für beide Seiten zum Stress mutiert.
Aber wie kommt es dazu, dass aus positiver Hilfsbereitschaft etwas Negatives entsteht?
„Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten.“
Abraham Lincoln (1809 - 1865), der 16. US-amerikanische Präsident
Solidarisches versus pathologisches Helfen
Generell wird unterschieden in das solidarische und das pathologische Helfen. Das solidarische Helfen zielt auf die Bedürfnisse des Gegenübers ab. Hingegen stehen beim pathologischen Helfen die Bedürfnisse des Helfers im Vordergrund. Man bezeichnet das auch als "pathologischer Altruismus".
![]()
Wie entsteht das Helfersyndrom?
Es gibt verschiedene Ursachen für die Entstehung, aber zumeist sind die Grundlagen dafür in der Kindheit gelegt worden. Wenn Kinder von ihren Eltern nur Anerkennung erfuhren, wenn sie hilfreich waren oder wer als Kind erlebt, dass der eigene Wert von der Anerkennung anderer abhängig ist, der entwickelt ein geringes Selbstwertgefühl und Schuldgefühle, wenn er nicht immer und stets hilfsbereit ist. Es besteht die Gefahr, dass ein Helfersyndrom entsteht.
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“
So formulierte es Goethe einst in seinem Gedicht "Das Göttliche". Dieser Glaubenssatz in massiver Ausprägung steckt in so manchem mit Helfersyndrom. Die Formel (Glaubenssatz) lautet also:
Wenn ich anderen helfe und meine Wünsche zurückstelle, dann bin ich gut. Dann habe ich einen Wert und mein Leben einen Sinn.
Definition Helfersyndrom
Helfersyndrom als Begriff wurde vom Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer 1977 eingeführt. Es bezeichnet den Hang einer Person, in zwischenmenschlichen Beziehungen, sich stets als Helfer anzubieten. Es ist häufig in sozialen Berufen anzutreffen, zum Beispiel bei Altenpflegern, Sozialarbeitern aber auch bei Therapeuten und Beratern. Wolfgang Schmidbauer unterscheidet dabei vier verschiedene Typen:
Opfer des Berufs: Hier dominiert bei einer Person das Berufsleben und das Privatleben kommt viel zu kurz.
Spalter: Ein Spalter verhält sich in seiner beruflichen Rolle völlig anders als im Privatleben.
Perfektionist: Sie oder er erwartet in allen Lebensbereichen Perfektion.
Pirat: Diese Person nutzt die berufliche Vormachtstellung für private Interessen aus.
Beitrag: Perfektionismus überwinden – 12 Empfehlungen und wirksame Werkzeuge
Perfektionismus überwinden – 12 Empfehlungen

Perfektionismus überwinden – 12 Empfehlungen und wirksame Werkzeuge
Die Verwendung des Wortes Perfektionismus ist nicht ungefährlich, denn zu leicht wollen wir damit verteufeln, verurteilen und kritisieren. Doch, wo wären wir ohne ihn. Es gab und gibt Menschen, deren Motor dreht mit dem Turbolader "Perfektion". Das ist für das Umfeld nicht immer angenehm, aber manchmal entstehen eben auch großartige Erfindungen und Produkte.
Deswegen möchte ich dich einladen in die Welt der Gefahren und Chancen des Perfektionismus. Wo ist er hilfreich und wo kann er gefährlich werden? Was kannst du tun, um ihn zu nutzen? Was solltest du vermeiden, um dich vor den Gefahren zu schützen? Außerdem begleitet dich in diesem Artikel Mirco mit seiner persönlichen Geschichte zum Thema. Er hatte ein massives Perfektionsproblem und arbeitet nach einigen unschönen Erlebnissen im Alltag an diesem Thema.
Hier weiterlesen: Perfektionismus überwinden – 12 Empfehlungen
Schmidbauer geht noch einen Schritt weiter. Er ist der Auffassung, dass ein unbewusstes Motiv wirksam ist, das zum Helfersyndrom führen kann.
Den Betroffenen wurde als Kind vermittelt, dass sie für das Wohlergehen anderer verantwortlich sind. So wurden die eigenen Bedürfnisse immer unwichtiger und für die, denen sie helfen, sind sie quasi der fürsorgliche Elternteil, der ihnen selber in der Kindheit fehlte.
Menschen mit Helfersyndrom wollen so Wertschätzung erhalten und sie fürchten sich, abgelehnt zu werden. Doch nicht immer stößt dieses Verhalten bei anderen Menschen auf Gegenliebe. Der "Helfer" strengt sich noch mehr an, sucht nach Bestätigung und überfordert sich körperlich und geistig. Der Lohn bleibt aus … eine ungute Spirale "von Aufopferung und Nicht-Dankbarkeit bzw. Undank" wird in Gang gesetzt.
So kann es zur totalen Erschöpfung, psychosomatischen Erkrankungen bis hin zu Burnout oder zur Depression kommen. Eine therapeutische bzw. psychologische Unterstützung ist bei der letzteren dann unvermeidlich.
Frage dich bitte auch einmal selbst: "Habe ich vielleicht ähnliche Glaubenssätze oder bin ich gar bereits in einen Burnout geschlittert?" Unsere Artikel helfen beim Finden der Antwort:
Beitrag: Was sind meine Glaubenssätze? Erkennen und verändern in 3 Schritten

Was sind meine Glaubenssätze? Erkennen und verändern in 3 Schritten
Glaubenssätze sind Annahmen über uns und darüber, wie die Welt um uns herum abläuft. Sie leiten uns an, wie wir uns am besten in der Welt "bewegen". Wer sein Leben selbstbestimmter, erfolgreicher und glücklicher führen möchte, der hat häufig bei seinen Glaubenssätze einen guten Ansatzpunkt.
Wenn wir das nicht tun, kann es sein, dass wir Marionetten unserer Erziehung sind und nicht zuletzt wie Orientierungslose den Einflüsterungen der Werbung folgen. Das sollten wir nicht zulassen. Lies hier, was du tun kannst, um deine Glaubenssätze zu erkennen und sinnvoll für deinen weiteren Lebensweg anzupassen. Schleppe nicht unnötiges Gepäck mit dir herum, das zieht nur herunter und bremst dich.
Hier weiterlesen: Was sind meine Glaubenssätze?
Beitrag: Burnout – was tun? Grundwissen Burnout, 8 bewährte Gegenmittel & Strategien zur künftigen Vermeidung
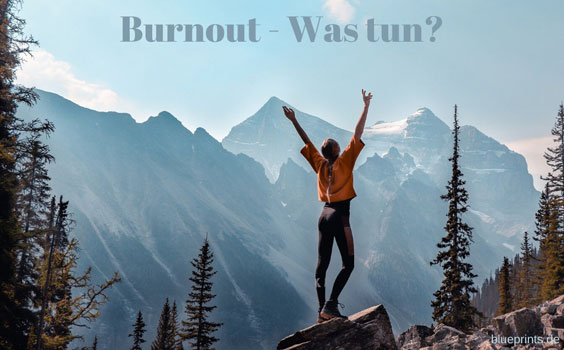
Burnout – was tun? Grundwissen Burnout, 8 bewährte Gegenmittel & Strategien zur künftigen Vermeidung
So mancher erleidet den Burnout aufgrund von Umständen, die ihm notwendig erscheinen. Ein anderer erlebt Stress, weil er sich immer wieder etwas Neues vornimmt und sich diesem anschließend verpflichtet fühlt.
Eine andere setzt sich unrealistische Ziele (oder erhält diese von anderen) und wird Opfer moderner Anpeitscher-Strategien wie "Du musst nur dran glauben!" – "Du schaffst das!" – "Andere schaffen das doch auch!" In diesem Artikel gehen wir dem Thema "Burnout" auf den Grund und zeigen auf, wie wir uns dagegen wappnen.
Hier weiterlesen: Burnout – was tun?
Tim Bendzko parodiert in seinem Lied das Helfersyndrom
Tim Bendzko – Nur noch kurz die Welt retten (Offizielles Video)
Was sind nun die "Warnsignale" des Helfersyndroms? Woran können wir es erkennen?
![]()
Woran erkennen wir das Helfersyndrom?
Die Folgen dieser ständigen Überforderung, gepaart mit einem schlechten Gewissen und einem Selbstverlust, münden nicht selten in Depression und Burnout.
Hier nun einige Hinweise und Symptome, die auf ein Helfersyndrom hinweisen könnten. Nutze auch die Umfrage unten als Selbsttest, ob bei dir ein Helfersyndrom vorliegt.
- Die Bedürfnisse der anderen stehen im Vordergrund.
- Die Welt ist erst in Ordnung, wenn jemand anderem geholfen werden kann – wenn sie oder er gebraucht wird.
- Der Helfer macht sich unentbehrlich. Es kommt zur Abhängigkeit zwischen Helfer und Geholfenem.
- Große Nachsicht mit den Schwächen anderer und keine Nachsicht mit den eigenen.
- Betroffene können im Alltag nicht "Nein" sagen.
- Aus Beziehungen, in denen sie oder er nicht die Wirksameren sind, halten sie sich fern.
- Helfer fragen nicht, ob sie helfen sollen. Hilfsbedürftigkeit ist nicht notwendig.
- Sich selbst etwas Gutes tun, erzeugt ein schlechtes Gewissen.
- Betroffene halten andere oft für undankbar, weil sie nicht merken, dass ihre Hilfe zu weit geht oder nicht gewollt ist.
- Sie fühlen sich ungerecht behandelt, sie leiden und werden melancholisch, wenn sie nicht stets Dank erfahren oder man sogar ihre Hilfe ablehnt.
- Sie entwickeln das Gefühl, selber nobel und selbstlos zu sein und erwarten Dank.
- Betroffene sind auf das Helfen fixiert. Sie helfen auch da, wo niemand nach Hilfe gefragt hat, was eine Beziehung belasten kann.
- Sie fühlen sich egoistisch, wenn sie nicht zuerst an andere denken.
„Hilf denen, die sich selbst nicht helfen können!“
Sprichwort

Nicht nur dem Partner helfen ist wichtig – aber ...
![]()
Selbsttest zum Helfersyndrom
Falls du reflektieren möchtest, ob du oder jemand anderes in deinem Umfeld zum Helfersyndrom tendiert oder gar schon betroffen ist, dann nutze die folgende Umfrage. Solltest du viele der Punkte auswählen, könnte es sein, dass du oder jemand anderes gefährdet ist.
WICHTIG: Dieser Test und das Lesen des Artikels ersetzen nicht den Rat eines professionellen Helfers. Lass dir unbedingt helfen, wenn du den Eindruck hast, dass du davon betroffen bist. Sollte jemand anderer deiner Meinung nach das Helfersyndrom haben, könnte ein erster Schritt das Lesen dieses Artikel sein. Häufig merken Betroffene nicht, dass das Helfersyndrom ein massives Problem sein kann.
Welche der Aussagen treffen auf dich oder jemand anderen zu?
Bitte wähle die Antworten aus, die ungefähr auf dich oder jemand anderen passen. Bitte sei ehrlich.
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Die bisherigen Stimmen:
| Ich kann selten NEIN sagen, wenn andere mich um Hilfe bitten. | 903 Stimmen |
| Ich fühle mich gut und wertvoll, wenn ich helfe. | 850 Stimmen |
| Ich ärgere mich manchmal, dass meine Hilfe auf keinen Dank stößt. | 558 Stimmen |
| Ich helfe oft, auch wenn man mich nicht gebeten hat. | 514 Stimmen |
| Ich fühle mich nicht gut, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht helfen kann. | 482 Stimmen |
| Ich fühle mich egoistisch, wenn ich nicht zuerst an andere denke. | 425 Stimmen |
| Ich habe fast nie Zeit für mich, weil ich ständig damit beschäftigt bin, anderen zu helfen. | 380 Stimmen |
| Wenn ich mir selbst etwas Gutes tue, habe ich fast ein schlechtes Gewissen. | 371 Stimmen |
| Mir haben bereits andere gesagt, dass ich es mitunter mit dem Helfen übertreibe. | 334 Stimmen |
| Ich leide bereits an Burnout und/oder Depression, weil so viele Menschen etwas von mir wollen. | 289 Stimmen |
| Wenn jemand meine Hilfe ablehnt, bin ich verärgert. | 247 Stimmen |
Auswertung zum obigen Selbsttest
Bis zu 2 Punkte angekreuzt: Du leidest vermutlich nicht unter dem Helfersyndrom.
3 bis 4 Punkte angekreuzt: Bearbeite die Punkte unter "Was tun gegen das Helfersyndrom?" und mache mit etwas Abstand den Test noch einmal.
Mehr als 4 Punkte angekreuzt: Eventuell solltest du dir professionelle Hilfe suchen.
Bitte beachte: Dieser Selbsttest kann nicht die Analyse von Fachleuten ersetzen. Generell möchte wir empfehlen, sich lieber früher als später Hilfe an seine Seite zu holen.
![]()
Warum kann das Helfersyndrom problematisch sein?
Das Helfersyndrom ist keine psychische Erkrankung, kann aber im schlimmsten Fall dazu führen. Wer das Phänomen kennt und seine Grenzen nicht erkennt, der kann in einer tiefen Depression enden. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dann unbedingt die Hilfe eines Psychologen oder Psychotherapeuten notwendig ist. Das Aufarbeiten eines Traumas ist so möglich.
Für viele ist dieser Schritt aber immer noch mit einem Makel behaftet. Wer aber so mit der Zeit sein Selbstwertgefühl wiedergewinnt, seine Persönlichkeit weiter entwickelt und ein realistisches Selbstbild aufbaut, um wieder glückliche Beziehungen zu haben und etwas für seine seelische und körperliche Gesundheit getan hat, der wird den mutigen Schritt sicher nicht bereuen.
Unterschätzen wir nicht die körperlichen und seelischen Belastungen der Helfer.

Ausgelaugt und helfen müssen oder helfen, um es gemeinsam zu schaffen.
![]()
Was tun gegen das Helfersyndrom?
Damit es gar nicht so weit kommt, können wir einige Maßnahmen immer wieder durchführen.
Verbesserung des Selbstbildes
Hierbei geht es darum, sich immer wieder klar zu machen, dass der eigene Wert nicht nur von der Anerkennung anderer abhängig ist.
Merksatz: "Ich bin wertvoll und gut. Das muss man mir nicht ständig sagen."
Welches Bild hast du von dir? Einen weiterführenden Beitrag, um davon unabhängig zu werden, findest du hier:
Beitrag: Mich selbst mögen lernen – 4 erprobte Ansätze

Mich selbst mögen lernen – 7 erprobte Ansätze
Zu dick, zu unattraktiv, zu ungebildet, zu faul, zu unsportlich, zu ... Wir Zivilisationsmenschen sind auf verschiedenen Ebenen unzufrieden.
Als Gründe werden genannt: die ständige Präsenz von scheinbar makellosen Menschen aus der Werbung oder das Anschauen der Heldentaten, der grandiosen Liebhaber, der perfekten Leben in zumeist amerikanischen Spielfilmen.
Mit hinein spielt manchmal auch die missbrauchte Macht der Eltern: "Sei anders und ich hab dich wieder lieb." Wie können wir trotz all dieser Prägungen lernen, uns wieder selbst zu mögen?
Hier weiterlesen: Mich selbst mögen lernen
Selbstwertgefühl stärken
Dies ist generell hilfreich, um selbstbewusster das Leben zu meistern. Hier findest du Übungen und Tipps zum Thema sowie eine Reflexions- und Merkkarte als PDF zum Download:
Beitrag: Selbstwertgefühl stärken – die 6 Säulen und 6 Übungen

Selbstwertgefühl stärken – die 6 Säulen und 6 Übungen
Ein Thema, das unsere Leserinnen und Leser immer wieder bewegt, ist der Aspekt Selbstwert. Denn, wer sein Selbstwertgefühl stärkt, wird unabhängiger von der Meinung anderer und lebt angstfreier und selbstbestimmter. Was können wir tun, um im Hause Selbstbewusstsein einen Stock höher zu fahren, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren?
Helfen können hierbei die 6 Säulen des Selbstwertgefühls und 6 Übungen. Nutze auch die exklusive blueprints Merk- und Reflexionskarte und mache bei der anonymen Umfrage mit.
Hier weiterlesen: Selbstwertgefühl stärken
Es auch sich recht machen
Hört sich profan an, fällt aber vielen schwer. Merksatz: "Wenn es mir gut geht, geht es auch anderen gut. So etwas ist ansteckend." Auch hierzu findest du einen Beitrag auf blueprints:
Beitrag: Es allen recht machen wollen – das Problem, der Antreiber und die 5 Lösungsschritte
Es allen recht machen wollen – das Problem, der Antreiber und die 5 Lösungsschritte

Es allen recht machen wollen – das Problem, der Antreiber und die 5 Lösungsschritte
Wer das Patentrezept für das Scheitern sucht, der sollte genau das probieren: "Versuche, es allen recht zu machen". Wie formulierte es Franz-Josef Strauß einst so treffend: "Everybody's Darling is Everybody's Depp".
Menschen, die es jedem recht machen möchten, haben einen schweren Stand, denn das ist nicht möglich und raubt viel Energie. Außerdem führt dieses Verhalten häufig zu dem, was der Handelnde gerade nicht will. Lies hier, warum diese Verhaltensweise quasi eine Falle ist und was wir dagegen tun können. Zeitkonto und Selbstwertgefühl werden es dir danken.
Weitere Stärken finden und nutzen
Es mag durchaus die Stärke eines Menschen mit Helfersyndrom sein "zu helfen". Doch, um sich vom Zwang zu befreien, wieder in ein ausgewogeneres Verhältnis zu kommen und als Betroffener Gefühle der Selbstwirksamkeit zu erleben, ist es wichtig, andere Stärken ebenfalls zu kennen und zu nutzen.
Hier findest du Tipps, Anregungen und eine Übung (auch zum Download) zum Thema:
Beitrag: Stärken und Schwächen – warum wir sie kennen sollten
Stärken und Schwächen herausfinden

Stärken und Schwächen herausfinden – warum wir sie kennen sollten
Hier weiterlesen: Stärken und Schwächen herausfinden
Anerkennung aus anderen Aktivitäten erhalten
Wer den Eindruck hat, dass er nur über das Helfen Anerkennung erhält, der sollte weitere Wege suchen, um diese zu erhalten. Vielleicht ist es der Sport, eine künstlerische Begabung oder der Beruf, wo wir Anerkennung erhalten könnten. Auch hier ist wichtig, dass wir das gesunde Maß nicht überschreiten. Eine Sucht durch eine andere zu tauschen wäre wenig hilfreich.
Nein sagen üben
Das ist keine einfache Übung für Menschen mit leichtem oder schwerem Helfersyndrom. Die Angst, vermeintlich nicht gemocht zu werden, sitzt tief. Aber wer es probiert merkt schnell, dass die Konsequenzen gar nicht so schlimm wie befürchtet ausfallen. Wie so häufig ist der Ton entscheidend und wie das Nein begründet wird. Aber so etwas müssen wir erleben und nicht nur lesen. Hier findest du eine kurze Geschichte, Tipps und eine Übung zum Thema NEIN sagen.
Beitrag: NEIN sagen lernen – Tipps und die Geschichte von Laura
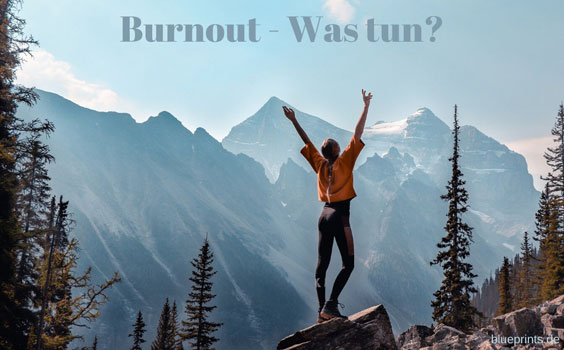
Burnout – was tun? Grundwissen Burnout, 8 bewährte Gegenmittel & Strategien zur künftigen Vermeidung
So mancher erleidet den Burnout aufgrund von Umständen, die ihm notwendig erscheinen. Ein anderer erlebt Stress, weil er sich immer wieder etwas Neues vornimmt und sich diesem anschließend verpflichtet fühlt.
Eine andere setzt sich unrealistische Ziele (oder erhält diese von anderen) und wird Opfer moderner Anpeitscher-Strategien wie "Du musst nur dran glauben!" – "Du schaffst das!" – "Andere schaffen das doch auch!" In diesem Artikel gehen wir dem Thema "Burnout" auf den Grund und zeigen auf, wie wir uns dagegen wappnen.
Hier weiterlesen: Burnout – was tun?
Selbst Hilfe annehmen
Auch hier haben Betroffene Probleme. Hilfe annehmen fällt ihnen schwer. "Ich bin der, der hilft. Ich bin stark. Ich schaffe das alleine", sind dann mögliche Gedanken.
Das mag sein. Aber für jene mit diesen Gedanken hier eine Idee für einen Merksatz: "Ich bin stark und kann auch um Hilfe bitten. Wurde mir geholfen, bedanke ich mich! Auch das gehört zu guten Beziehungen – ob privat oder beruflich."
Ich möchte Hilfe geben und keine Hilfe bekommen.
Gespräche über das Thema
Mit seiner Freundin, seinem Freund oder einem persönlich geschätzten Ratgeber über das Thema zu reden erfordert vielleicht ein wenig Mut, kann jedoch sehr hilfreich sein. Zum einen werden viele so merken, dass sie nicht alleine sind und eventuell gute Ideen erhalten. Wir haben alle unsere kleinen "Macken" und "Dellen". Allein das zu erkennen, kann helfen, sich auch ein wenig mit sich und anderen auszusöhnen. Das wiederum führt dazu, dass wir uns ein wenig mehr mögen - ein guter Start gegen das Helfer-Syndrom.
Literatur oder weitere Artikel zum Helfersyndrom lesen
Ob nun als Buch oder gute Artikel im Web, lesen hilft auf dem Weg zu neuen Wegen und Lösungen. Hier einige Buchtipps zu den Themen:
- Was bedeutet Helfer-Syndrom?
- Wie kann jemand sich vom Helfer-Syndrom befreien?
- Wie kann man das schaffen?
🛒 "Helfersyndrom" auf Amazon anschauen ❯
„Suche immer zu nützen! Suche nie, dich unentbehrlich zu machen.“
Freifrau Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916), österreichische Schriftstellerin
![]()
Umgang mit Menschen mit Helfersyndrom
Ob nun in der Beziehung oder im Freundeskreis, das Helfersyndrom kann Beziehungen belasten und vor Zerreißproben stellen.
Ein Gespräch zu suchen, das möglichst frei von Vorwürfen und Angriffen ist, wäre hilfreich. Deswegen sollten solche Gespräche so früh wie möglich geführt werden.
Wichtig ist, dass ein solches Gespräche nicht vor Publikum geführt wird. Das könnte dazu führen, dass der Helfer sich bloßgestellt fühlt. Sich für das Gespräch Zeit nehmen, und falls die Gefahr besteht, dass man emotional wird, ist es immer ratsam, sich vorher schriftlich Notizen zu machen. Denn das Problem ist, wenn wir emotional werden, blockieren wir zumeist gedanklich. Also bitte keine Vorwürfe machen, sondern nennen von nachvollziehbaren Beispielen und Einschätzungen der Situation.
Hilfreich ist es, sich an die Regeln des Feedbacks zu halten. Erst die Beschreibung, dann die Bewertung und dann mögliche Konsequenzen, die sich auf Dauer aus dem Verhalten ergeben könnten. Einen Beitrag zum Thema findest du hier:
Kritik als Chance – Selbstbewusster werden

Kritik als Chance sehen – und selbstbewusster werden
Ob privat oder im Beruf - Kritik ist wichtig, um zu begreifen und zu reifen. Doch das mit der Kritik ist nicht so einfach, denn es sollten einige Regeln beachtet werden, damit Kritik Veränderungen auslösen kann. Denn eigentlich ist Kritik das, was uns wirklich vorwärtsbringt, wenn sie dem Empfänger hilft, sich weiterzuentwickeln.
Generell sollte Kritik so vorgebracht werden, dass eine weitere gute Beziehung oder bessere Zusammenarbeit möglich ist. Ob du deinem Partner Feedback gibst oder ein Mitarbeitergespräch führst, das hilfreiche Prinzip ist immer dasselbe. Probiere es einmal auf die folgende bewährte Vorgehensweise. Du und der Empfänger werden positiv überrascht sein und zusätzlich stärkt es das Selbstbewusstsein.
Selbstbewusster durch Kritik werden ► Die Vorteile von Kritik ► Richtig Kritik geben ► Wie ich innerlich klug mit Kritik umgehe ► Was ist bei Kritik wichtig? ► Umfrage ► Pareto-Tipp zum Thema ► Weitere Beiträge und Übungen zum Thema "Kommunikation"
Hier weiterlesen: Kritik als Chance sehen
Keiner mag in Gesprächen Schweinchenschlau oder Besserwisser, sondern wir brauchen Menschen, die zuhören und uns wertschätzend behandeln.
![]()
Zusammenfassung
Versteckt im Mantel der Hilfsbereitschaft kommt es daher – das Helfersyndrom.
Eigentlich ja eine großartige Eigenschaft, anderen zu helfen, altruistisch zu sein, aber wie bei fast allem – die Dosis macht es.
Wer bei sich bemerkt, dass er es immer wieder ein wenig übertreibt mit dem Helfen, dem empfehlen wir, nach weiteren Anzeichen für ein Helfersyndrom zu suchen. Bestätigt sich die erste Einschätzung, sind verschiedenste Maßnahmen hilfreich, um die Hilfsbereitschaft zu dosieren und die eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen.
Helfende Menschen brauchen wir mehr denn je in unserer Gesellschaft. Das richtige Maß ist entscheidend, um sich selbst nicht aufzuopfern, enttäuscht zu werden oder Beziehungen zu verschlechtern.
![]()
Merk- und Reflexionskarte "Helfersyndrom überwinden"
Hier findest du die Merk- und Reflexionskarte zum Thema. Die Karte ist im Quartettformat (6 x 9 cm), passt also bequem in die Jackentasche oder in die Geldbörse.
- Du hast kurz und kompakt die wichtigsten Punkte zum Thema.
- Du kannst die Karte als Gedankenstütze mitnehmen.
- Durch die Kurzform merkst du dir das Wesentliche leichter.
![]()
blueprints-Pareto-Tipp: Was tun gegen das Helfersyndrom?
„Frage dich, ob du Dank und Aufwertung erwartest, wenn du hilfst. Überlege auch, ob Hilfe wirklich gewünscht ist und gut für den anderen. Denn wir könnten verhindern, dass der andere lernt, es selber zu tun. Helfe denen, die es wirklich brauchen, aber nicht allen, nur um dich gut zu fühlen.“
![]()
Filmbeiträge
Video: Das Helfersyndrom – Wenn das Helfen zum Problem wird | CarBas
Länge: 3:58 Minuten
Audio: PSYCHOTHERAPIE AUSBILDUNG – Das Helfersyndrom – die hilflosen Helfer
Länge: 6:01 Min.
Geschrieben von

Michael Behn
Michael arbeitet als Trainer und Coach im Bereich Kommunikationstraining und Selbstmanagement. Er arbeitet bundesweit für kleine und mittelständische Unternehmen. Schwerpunkt sind Führungstrainings, Verkaufstrainings und das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Er ist Gründer von blueprints, was seit dem Jahr 2000 eine Leidenschaft von ihm ist. -> Michael Behn auf Xing: https://www.xing.com/profile/Michael_Behn/web_profiles ||| Beraterprofil: https://www.behn-friends.de/fileadmin/user_upload/PDF/bf-Trainer-_und_Beraterprofil-Michael-Behn-19U.pdf
- Details
- Geschrieben von: Michael Behn

