Richtig Feedback geben lernen – Tipps, Methoden & Beispiele
Stell dir vor, dein Chef sagt seit Wochen kein Wort zu deiner Arbeit. Keine Rückmeldung, weder Lob noch Kritik. Du weißt nicht, woran du bist – frustrierend, oder? Gutes Feedback ist wie ein GPS fürs Verhalten: Es zeigt dir, ob du auf dem richtigen Weg bist, und hilft dir zu korrigieren, wenn du dich verfährst. Feedback geben zu lernen gehört deshalb zu den wichtigsten Fähigkeiten im Beruf und im Alltag. Ohne Feedback gibt es kaum Fortschritt – „Lernen ohne Feedback ist kaum möglich“, betont Führungsexperte Bernd Geropp. Eine aktuelle Gallup-Studie untermauert das: 80 % der Mitarbeiter, die in der letzten Woche sinnvolles Feedback erhalten haben, sind hoch engagiert bei der Arbeit. Feedback ist also keine Nebensache, sondern ein Motor für Motivation und Leistung.
Bild: Ein Vorgesetzter und Mitarbeiter im Gespräch – regelmäßiges, konstruktives Feedback fördert Vertrauen und Engagement.
In diesem Artikel erfährst du, warum Feedback eine Schlüsselkompetenz ist und wie du richtig Feedback geben lernen kannst – mit praxisnahen Strategien, Beispielen und Tipps. Wir schauen uns an, was gutes Feedback ausmacht, wie du Feedback üben und auch annehmen kannst, welche Fehler du vermeiden solltest und sogar, welche kulturellen Unterschiede es gibt. Egal ob du Azubi, erfahrene Führungskraft, Lehrer oder einfach jemand bist, der sich persönlich weiterentwickeln möchte – hier findest du Inspiration und konkrete Ratschläge, um Feedback künftig souverän und wirksam zu nutzen. Los geht’s!
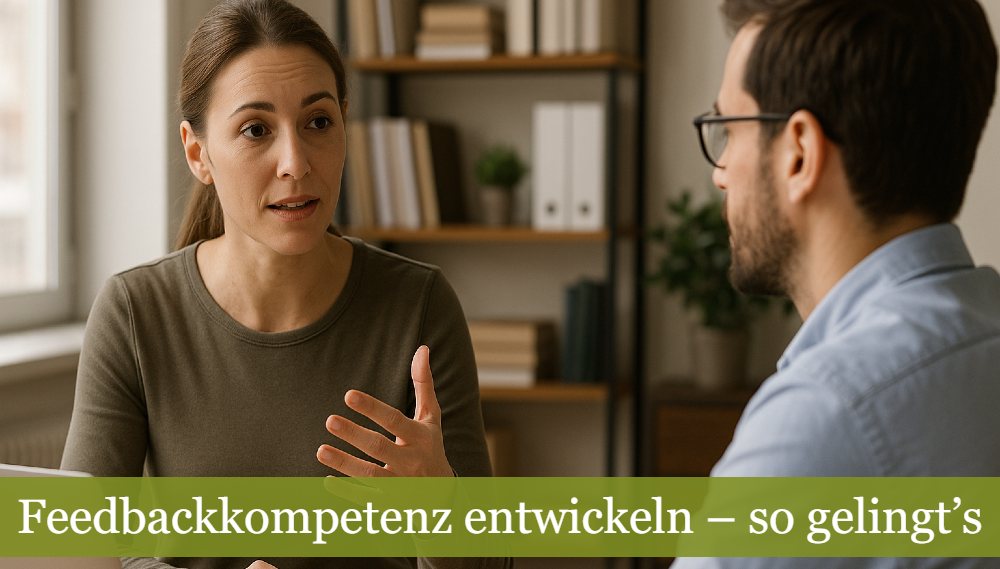
Kurz zusammengefasst
- Feedback als Schlüsselkompetenz
→ Ohne Feedback ist Weiterentwicklung nur schwer möglich – im Beruf und im Privaten. Es ist essenziell hilfreich für Motivation, Lernprozesse und zwischenmenschliche Beziehungen. - Merkmale guten Feedbacks
→ Effektives Feedback ist konstruktiv, konkret, respektvoll, zukunftsorientiert und wird zeitnah gegeben. Die Haltung dahinter ist genauso wichtig wie die Wortwahl. - Methoden & Strategien
→ Strukturen wie die WWW- oder SBI-Methode helfen dabei, klar und ohne Vorwürfe zu kommunizieren. Wichtig ist auch, Feedback als Dialog zu gestalten – nicht als Monolog. - Feedback empfangen
→ Offenheit, innere Ruhe und die Fähigkeit, zwischen sachlicher Kritik und persönlicher Ebene zu unterscheiden, fördern eine resiliente Feedbackkultur. Fragen stellen hilft beim Verstehen. - Digitales Feedback
→ Neue Tools und hybride Arbeitsformen bieten Chancen, bergen aber auch Risiken wie Missverständnisse oder Feedbacküberflutung. Persönliche Gespräche bleiben unverzichtbar. - Häufige Fehler
→ Sandwich-Methode, pauschale Aussagen, falscher Zeitpunkt oder fehlende Nachbetreuung können Feedback unwirksam oder sogar schädlich machen. - Kulturelle Unterschiede
→ Feedback-Stile variieren je nach Kultur stark: Direktheit, Hierarchieverständnis und Gruppendenken beeinflussen, wie Rückmeldungen gegeben und angenommen werden. - Fazit: Beziehung statt Bewertung
→ Wer Feedback als Beziehungsarbeit versteht, fördert Vertrauen, Leistung und persönliche Entwicklung. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der Mut und Reflexion erfordert.
Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.
Einführung: Warum Feedback eine Schlüsselkompetenz ist
Das Wort Feedback kommt aus dem Englischen und bedeutet "Rückkoppelung". In der Kommunikation bietet Feedback die Möglichkeit des Lernens. Wir geben Feedback, um dem Anderen unsere Realität der wahrgenommenen Situation aufzuzeigen. Ein Feedback ist somit weder wahr noch falsch, sondern eine subjektive Beschreibung und Bewertung einer Situation, eines Verhaltens etc.
Wenn wir Feedback geben, ist es ratsam auf einige Punkte zu achten, um dem Anderen Lernen zu ermöglichen und Konflikte zu vermeiden. Denn "der Standpunkt macht es nicht: die Art macht es, wie man ihn vertritt", bemerkte einst der deutsche Dichter Theodor Fontane. Es geht also wie fast immer in der Kommunikation nicht um das WAS (den Inhalt), sondern um das WIE.
Warum reden alle von Feedbackkultur? Ganz einfach: Feedback – ob Lob oder Kritik – ist das Schmiermittel für Lernen und Zusammenarbeit. Ohne Rückmeldungen tappen wir im Dunkeln. Kein Wunder, dass Feedback geben und nehmen heute zur Schlüsselkompetenz zählt. Unternehmen wie Google haben erkannt, dass offenes Feedback die Leistung von Teams enorm steigert. Und im Bildungsbereich zeigt die Forschung seit John Hattie: Feedback gehört zu den einflussreichsten Faktoren für Lernerfolg. Kurz:
Wer Feedback beherrscht, kann andere besser entwickeln und selbst wachsen.
Doch Feedback geben ist gar nicht so einfach. Viele zucken innerlich zusammen, wenn sie hören: „Kann ich dir mal Feedback geben?“ – laut Gallup gehören diese sechs Wörter zu den meistgefürchteten im Büro. Warum? Weil Feedback oft mit Vorwürfen oder peinlichen Situationen verknüpft ist. Genau hier setzen wir an: Du wirst lernen, Feedback positiv zu begreifen – als Geschenk und Chance, nicht als Angriff. Ein Chef, der gekonnt Feedback gibt, formt engagierte, lernfreudige Teams. Lehrkräfte, die ihren Schülern konstruktiv Rückmeldung geben, sehen sie über sich hinauswachsen. Und im Privatleben? Auch hier stärkt ehrliches Feedback das Verständnis und Vertrauen in Beziehungen.
Keine Sorge: Man kann richtig Feedback geben lernen. 😉
Feedback geben lernen: Wie bei jeder Fähigkeit braucht es etwas Übung und Wissen um die richtigen Techniken.
Im Folgenden tauchen wir tiefer ein: Was macht gutes Feedback konkret aus? Wie findest du die passenden Worte und den richtigen Ton? Und wie bleibt man offen, wenn man selbst kritisches Feedback bekommt? Mit jedem Abschnitt wirst du sicherer im Umgang mit dem “Feedback-Werkzeug”. Du bist bereit? Dann schauen wir uns zuerst an, was gutes Feedback eigentlich auszeichnet – und welche Wirkung es entfalten kann.
Wie häufig erhältst du konstruktives Feedback bei der Arbeit?
Was gutes Feedback ausmacht: Merkmale und Wirkung
Gutes Feedback ist wie ein Spiegel, der klar zeigt, was ist – ohne zu verzerren. Aber was heißt das konkret? Hier die wichtigsten Merkmale, die konstruktives Feedback von bloßer Kritik unterscheiden:
- Konstruktiv und konkret: Anstatt pauschal zu sagen „Das war schlecht“, beschreibt gutes Feedback konkretes Verhalten. Beobachtung statt Bewertung lautet die Devise. Beispiel: „In der Präsentation hast du oft schnell gesprochen, dadurch fiel es mir schwer zu folgen.“ So weiß der Empfänger genau, was gemeint ist und warum es ein Problem darstellt. Studien zeigen, dass spezifisches Feedback viel eher zu Verbesserungen führt.
Kritik innerhalb von 3 Tagen äußern, Lob innerhalb von 1 Woche.
- Zeitnah und regelmäßig: Der richtige Zeitpunkt ist Gold wert. Idealerweise gibst du Feedback kurz nach dem beobachteten Verhalten, solange es frisch ist. Monate später nützt es kaum noch. Warte aber nicht erst aufs jährliche Mitarbeitergespräch – häufiges, kurzes Feedback wirkt besser als ein großer Rundumschlag einmal im Jahr. Die Faustregel eines Expertenblogs: Kritik innerhalb von 3 Tagen äußern, Lob innerhalb von 1 Woche. So bleibt Feedback relevant und glaubwürdig. Kein Wunder, dass Generation Z im Job sogar Feedback jede Woche oder häufiger erwartet – sie sind mit Likes und Kommentaren in Echtzeit aufgewachsen.
„Das Vergnügen, andere mit Lob zu überschütten, sollten wir uns viel öfter gönnen.“
- Balance aus Lob und Kritik: Nur kritisieren oder nur loben? Beides gehört zu gutem Feedback. Wichtig ist die richtige Balance. Anerkennung für Positives motiviert und zeigt, dass du die Leistungen wirklich wahrnimmst. Kritische Punkte weisen den Weg, wo jemand wachsen kann. Viele Experten empfehlen, mit etwas Positivem zu beginnen, um den Empfänger zu öffnen. Aber Achtung: vermeide ein starres Lob-Kritik-Lob-Schema als Trick (dazu später mehr). Vielmehr sollte Lob ehrlich und verdient sein. Ein tolles Zitat dazu stammt vom Schriftsteller Ernst Ferstl: „Das Vergnügen, andere mit Lob zu überschütten, sollten wir uns viel öfter gönnen.“ 😉 In der Tat: Wer regelmäßig Wertschätzung ausdrückt, schafft ein Vertrauenspolster, auf dem Kritik besser angenommen wird.
Verhalten kritisieren – nicht Personen.
- Ich-Botschaften und respektvoller Ton: Die Worte machen die Musik. Gutes Feedback kommt ohne Angriffe aus. Statt „Du bist unzuverlässig!“ lieber „Ich habe bemerkt, dass die letzten zwei Deadlines nicht gehalten wurden…“. Durch Ich-Botschaften sprichst du aus deiner Perspektive und vermeidest Schuldzuweisungen. Bleib respektvoll im Ton, so dass klar wird: Du kritisierst das Verhalten, nicht die Person. Diese Haltung – Respekt und Wohlwollen – spürt man zwischen den Zeilen. Sie entscheidet, ob dein Gegenüber dichtmacht oder zuhört.
- Zukunftsorientiert und lösungsorientiert: Vergangenes lässt sich nicht ändern, aber aus Fehlern kann man lernen. Effektives Feedback zeigt daher nach vorn: „Beim nächsten Mal könntest du versuchen, XYZ, um es besser zu machen.“ So gibst du konkrete Hinweise oder gemeinsam entwickelt ihr Lösungen. Dieser Coaching-Ansatz motiviert mehr als reines Aufzählen von Versäumnissen. Frag ruhig auch: „Wie siehst du das selbst? Was würdest du künftig anders machen?“ – So wird Feedback zum Dialog (dazu gleich mehr).
Wenn diese Merkmale zusammenkommen, entfaltet Feedback eine positive Wirkung. Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und fair behandelt, was die Zufriedenheit steigert. Gleichzeitig wissen sie konkret, was sie verbessern können – das erhöht die Leistungsbereitschaft. Kein Wunder, dass Unternehmen mit guter Feedbackkultur oft innovativer und agiler sind. Eine Gallup-Analyse fand heraus: Mitarbeiter sind 3,6-mal motivierter zu herausragender Arbeit, wenn sie täglich Feedback vom Vorgesetzten erhalten, statt nur einmal jährlich. Gutes Feedback wirkt also wie Dünger – es lässt Menschen und Leistungen florieren.
Zudem stärkt es die Beziehung zwischen Feedbackgeber und -nehmer. Wenn wir ehrlich kommunizieren, zeigen wir Vertrauen. Missverständnisse werden ausgeräumt, Konflikte frühzeitig geklärt. Im besten Fall entsteht eine offene Gesprächskultur, in der jeder vom anderen lernen kann. Oder wie es ein Gallup-Autor formulierte: Was man eigentlich will, ist einen offenen, ehrlichen Dialog auf Augenhöhe, der Beziehungen stärkt, statt einseitiger Ansagen und Kritik.
Genau das macht erstklassiges Feedback aus: Es ist klar, konstruktiv und kommt mit Herz und Verstand – so dass es Wachstum ermöglicht, ohne zu verletzen.
Welche Form von Feedback empfindest du als am hilfreichsten?
Feedback geben lernen: Strategien, Methoden, Formate
Du fragst dich vielleicht: Kann man gutes Feedback wirklich lernen? Absolut! Es gibt erprobte Strategien und Methoden, um Feedback-Gespräche erfolgreich zu gestalten. Hier ein Werkzeugkasten für angehende Feedback-Profis:
🎯 Die richtigen Strategien
- Feedback als Dialog, nicht Monolog:
Vergiss den Chef als einsamen Kritiker auf dem Thron. Wirkungsvolles Feedback ist zweiseitig. Gib deinem Gegenüber Raum, seine Sicht zu schildern oder Fragen zu stellen. Zum Beispiel: „Wie siehst du selbst den Projektverlauf?“ So fühlt sich niemand überfahren. Ihr arbeitet gemeinsam an einer Lösung, statt dass einer „gewinnt“ und der andere „verliert“. Diese Coach-Haltung („Wie kann ich dem anderen helfen, besser zu werden?“) ist der Kern guter Feedbackgespräche. - Ich-Botschaften üben:
Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, solltest du Feedback in Ich-Form ausdrücken. Das kann man üben! Stell dir Situationen vor und formuliere sie um: Aus „Du bist unorganisiert“ wird „Mir ist aufgefallen, dass deine Unterlagen oft fehlen…“. Nimm dir einen Kollegen oder Freund und trainiert solche Formulierungen. Es gibt auch Tools: etwa Übungskarten, Apps oder Kurse, die typische Szenarien durchspielen.
Tipp: Notiere dir vor einem wichtigen Feedbackgespräch ein paar Kernbotschaften als Ich-Aussagen. Das gibt Sicherheit und hält dich auf konstruktivem Kurs. - Positives Feedback nicht vergessen:
Oft konzentrieren wir uns nur auf Probleme. Doch Lob gezielt aussprechen will gelernt sein! Versuch mal Folgendes: Nimm dir nächste Woche vor, jeden Tag mindestens einem Kollegen etwas Positives rückzumelden – etwa „Dein detailliertes Protokoll hat uns sehr geholfen, danke!“. Anfangs mag es ungewohnt sein, aber du wirst sehen: Die Augen deines Gegenübers werden leuchten 😊. Positives Feedback schafft Vertrauen und erhöht die Bereitschaft, auch kritische Hinweise anzunehmen.
Bonus: Es fühlt sich auch für dich selbst richtig gut an, andere ehrlich zu loben. - Kritik konstruktiv verpacken:
Konstruktiv heißt nicht, Probleme schönzureden, sondern Lösungswege aufzuzeigen. Nutze die WWW-Methode:
- Wahrnehmung,
- Wirkung,
- Wunsch.
Erst beschreibst du deine Beobachtung (Wahrnehmung), dann deren Auswirkung (Wirkung) und schließlich sagst du, was du dir künftig anders wünschst.
Beispiel: „Mir ist aufgefallen, dass du in Meetings oft ins Smartphone schaust (Wahrnehmung). Das lenkt auch andere ab und wichtige Infos gehen verloren (Wirkung). Ich würde mir wünschen, dass wir alle voll bei der Sache sind – könntest du dein Handy künftig stumm lassen? (Wunsch)“. Diese Methode hält das Feedback konkret, sachlich und zukunftsorientiert. Sie eignet sich sogar, Kollegen untereinander Feedback geben zu lassen, weil sie einfach und klar strukturiert ist.
Weitere Beispiele zur WWW-Methode
Zuerst beschreiben
- "Wie du mit mir eben gesprochen hast, hat mir nicht gefallen."
- "Das eine sag ich dir! Wenn du so mit mir umgehst, dann ..."
- "Das Projekt hast du aber gut geleitet!"
Eine pauschale Bewertung der Situation ist nicht hilfreich. Was genau ist gemeint, wenn wir von "DAS hast du aber gut gemacht" sprechen? Welche genauen Inhalte, Sätze, Formulierungen waren es, die mir nicht gefallen haben?
Starte also mit einer genauen Beschreibung. Nenne wenn mögiich Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) oder wiederhole bestimmte Sätze bzw. Gesprächssequenzen.
Weitere Beispiele:
- "Du sagtest >Ich muss das so und so machen…<"
- "Auf meine Frage ... hast du erwidert..."
- "In deinem Projekt hast du innerhalb von maximal 2 Tagen jeden informiert..."
Nun erst folgt die Bewertung
Wer hört: "Das hat mich geärgert...", "Das eine sag ich dir..." oder "Wie du mit mir eben gesprochen hast, hat mir nicht gefallen", der hört kaum noch aufmerksam zu, sondern arbeitet in Gedanken schon an seiner Rechtfertigungs- bzw. Verteidigungsstrategie. Adrenalin wird ausgeschüttet (Angriff, Drohung, Konflikt) und man kann davon ausgehen, dass im Anschluss kaum noch über die Sache diskutiert wird.
Beispiele:
- "Du sagtest >Ich muss das so und so machen...<, dass wirkte auf mich sehr oberlehrerhaft..." (Anmerkung: Du sagst also, dass es auf dich so wirkte und nicht, dass das so generell wirkt.)
- "Auf meine Frage ... hast du erwidert... Bei mir entstand so der Eindruck, dass du dich dafür in keiner Form interessierst." (Anmerkung: Seine Reaktion war also nicht generell falsch, sondern seine Reaktion wirkte auf DICH in dieser Form.)
- "In deinem Projekt hast du innerhalb von maximal 2 Tagen jeden informiert, dass hat für mich maßgeblich zum Erfolg beigetragen und mir sehr gut gefallen."
Konsequenz immer zum Schluss
Wenn du dem anderen (aus deiner Sicht!) die möglichen Konsequenzen (auch Hoffnung, Wunsch, Bitte etc.) aufzeigen möchtest, dann tue dies bitte erst ganz zum Schluss, also nach Beschreibung und Bewertung.
Nicht: "Ich werde dir gar nichts mehr erzählen (Konsequenz), denn deine oberlehrerhafte Art auf meine Fragen zu antworten nervt" (Bewertung)"
Alternative:
- "Du sagtest >Ich muss das so und so machen...<, dass wirkte auf mich sehr oberlehrerhaft... Diese Art führt bei mir sicher dazu, dass ich dich nicht mehr so oft Fragen werde."
- "Auf meine Frage ... hast du erwidert...(Beschreibung). Bei mir entstand so der Eindruck, dass du dich dafür in keiner Form interessierst (Bewertung). In Zukunft werde ich mir überlegen, ob ich dir weiter von diesen Ideen erzählen werde."
- "In deinem Projekt hast du innerhalb von maximal 2 Tagen jeden informiert, dass hat für mich maßgeblich zum Erfolg beigetragen und mir sehr gut gefallen. Dieses Vorgehen wird sicher Anderen ein gutes Beispiel sein."
- Auf Erlaubnis achten: Ein cleverer Trick, um Offenheit zu erhöhen: Frage, bevor du Feedback gibst. Etwa: „Darf ich dir kurz ein Feedback zu dem Meeting heute geben?“. Klingt höflich – und wenn der andere ja sagt, ist er mental bereit zuzuhören. Ungefragtes Feedback im falschen Moment kann dagegen abblocken. Natürlich musst du nicht bei jeder Kleinigkeit erst groß fragen, aber in sensiblen Fällen oder gegenüber empfindsamen Personen schafft diese Erlaubnis-Technik eine bessere Atmosphäre. Sie signalisiert Respekt und verhindert, dass dein Gegenüber sich überrumpelt fühlt.
- Methoden und Tools kennen:
Es gibt eine ganze Palette an Feedback-Formaten – vom schnellen Zuruf bis zum strukturierten Workshop. Ein paar Beispiele:- Blitz-Feedback: Kurz, spontan und oft mündlich. Z.B. „Danke für deinen Bericht, war sehr übersichtlich!“ – direkt nach dem Lesen. Solche Mini-Feedbacks halten alle auf dem Laufenden und kosten kaum Zeit.
- Strukturierte Feedbackrunden: Etwa im Team-Meeting jeder sagt eine Sache, die gut lief, und eine zur Verbesserung (manche kennen das als Start-Stop-Continue oder WWW/EBI – Was war gut? Was kann noch besser werden?). Solche Runden fördern eine offene Teamkultur, in der Feedback normal wird.
- 360-Grad-Feedback: Ein umfangreiches Format, besonders in Firmen: Mitarbeiter erhalten anonymisiertes Feedback von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und Kunden. Dadurch entsteht ein Rundumblick. Für Führungskräfte ist das sehr wertvoll, um blinde Flecken zu erkennen. Allerdings erfordert es Aufwand und eine Kultur, die mit anonymen Kritiken konstruktiv umgeht.
- Feedback-Tools & Apps: In digitalen Zeiten gibt es Tools wie Pulse-Umfragen oder anonyme Feedback-Apps, mit denen Mitarbeiter regelmäßig Feedback geben können. Einige Firmen nutzen z.B. wöchentliche Stimmungsbarometer oder Apps, in denen man Kollegen virtuell „Kudos“ (Lobkärtchen) schicken kann. Solche Tools können Feedback in den Alltag integrieren und Hemmschwellen senken. Wichtig ist aber, dass sie persönlich besprochenes Feedback ergänzen, nicht ersetzen.
- Feed-Forward: Statt nur rückwärts auf Fehler zu schauen, gibt es das Konzept Feed-Forward. Hier fokussiert man auf zukünftige Lösungen: „Was kann XY das nächste Mal anders machen?“ – ohne die alten Verfehlungen groß aufzuwärmen. Dieser Ansatz, u.a. vom Coach Marshall Goldsmith populär gemacht, kann gerade bei festgefahrenen Themen neuen Schwung bringen.
- Rollenspiele und Trainings: Nichts geht über praktisches Üben. Gute Arbeitgeber bieten Trainings an, in denen Mitarbeiter Feedback geben und annehmen üben. Aber auch im kleinen Rahmen kannst du trainieren: Schnapp dir einen vertrauten Kollegen und macht ein Rollenspiel. Einer gibt Feedback, der andere reagiert, dann tauschen. Im Anschluss besprecht ihr, wie es sich angefühlt hat. Das mag zunächst ungewohnt klingen, ist aber äußerst lehrreich! Solche Trockenübungen erhöhen die Sicherheit und lassen dich im Ernstfall ruhiger und souveräner agieren.
Die Erfahrung lehrt: Als junge Führungskraft tut man sich anfangs schwer, einem älteren Mitarbeiter kritisches Feedback zu geben. Dann kann die SBI-Methode (Situation-Behavior-Impact) helfen: Dabei schildert man zuerst die Situation, dann das beobachtete Verhalten, dann dessen Auswirkung. Oft wird berichtet, dass das Feedback plötzlich viel sachlicher und weniger konfrontativ rüberkommt. Mitarbeiter nehmen damit Feedback erstaunlich offen auf – weil man eben konkret bei der Sache bleibt und nicht seine Person angreift.
Fazit dieses Abschnitts: Feedback geben kann man lernen wie Fahrradfahren. Mit den richtigen Methoden (z.B. WWW, SBI), einer wertschätzenden Haltung und etwas Übung wirst auch du immer besser darin, klar und konstruktiv Feedback zu formulieren. Denk dran: Übung macht den Meister – also kleine Gelegenheiten nutzen, häufig Feedback austauschen und auch mal neue Formate ausprobieren. So entwickelst du dich vom unsicheren Kritiker zum Feedback-Coach, der andere unterstützt und motiviert.
Teamübung
Warum nicht ein kleines Feedback-Quiz im Team veranstalten? Jeder schreibt anonym auf, welches Feedback ihn/sie am meisten weitergebracht hat und welches am wenigsten – und dann rät die Gruppe, von wem welches stammt. So lernt man spielerisch, was gut ankommt und was nicht. 🎲
Umfrage: Kannst du eine Methode ergänzen oder am Beispiel schildern?
Kennst du weitere Strategien, Methoden oder Formate, um sinnvoll Feedback zu geben?
Kannst du obige Anregungen ergänzen oder mit einem eigenen Beispiel verdeutlichen? Vielen Dank!
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Antwort 1
Liebes Blueprints-Team,
ich finde, das ist mal wieder ein ganz hervorragende und umfassende Aufbereitung!
Ich habe einen Vorschlag für eine kleine redaktionelle Ergänzung.
Was hier als WWW-Methode erläutert wird, wurde mir kürzlich als die AID-Methode (Aid = Hilfe, bzw. hilfreiches Feedback) vorgestellt:
A ction,
I mpact,
D esired Behaviour
Ich wünsche eine erfüllte Woche,
Manfred Schroeder
Feedback empfangen: So entwickelst du Resilienz und Offenheit
Feedback geben ist die eine Sache – Feedback bekommen die andere. Hand aufs Herz:
Niemand hört gern Kritik über sich.
Ein kritischer Kommentar kann uns treffen wie ein Pfeil. Doch genau hier liegt die Chance: Wer lernt, Feedback resilient anzunehmen, wird zum wahren Champion der persönlichen Weiterentwicklung. In diesem Abschnitt schauen wir, wie du eine offene Haltung entwickelst und was tun, wenn das Feedback mal schmerzt.
🤔 Mentale Einstellung: Feedback ist kein persönlicher Angriff
Der wichtigste Schritt passiert im Kopf: Mache dir klar, dass Feedback dir helfen soll, nicht dich niederzumachen.
“Feedback ist keine Anklage, sondern eine Einladung, dich weiterzuentwickeln.”
Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Versuche, in der Kritik das Geschenk zu sehen: Jemand nimmt sich die Zeit, dir seine Sicht zu schildern, damit du wachsen kannst. Natürlich gelingt diese Haltung nicht von heute auf morgen, aber du kannst sie trainieren.
Tipp: Erinnere dich an eine Situation, in der dich Feedback wirklich weitergebracht hat – zum Beispiel als dich ein Lehrer auf eine Schwäche hinwies, an der du dann gearbeitet hast. Halte dir dieses positive Beispiel vor Augen, wenn du nächstes Mal Kritik hörst. Es hilft dir, den automatischen Abwehrreflex zu zügeln.
🧘 Ruhig bleiben und zuhören
Wenn dir jemand kritisches Feedback gibt, reagiert oft zuerst der Körper: Herzklopfen, Erröten, die Magengegend verkrampft sich. Das ist normal – unser Gehirn stuft Kritik als potenziellen sozialen Schmerz ein.
Resilienz bedeutet, diese erste Reaktion zu managen, statt zurückzuschießen. Atme einmal tief durch und höre aktiv zu, ohne sofort in Verteidigung zu gehen. Lass die andere Person ausreden. Konzentriere dich bewusst auf die Inhalte, nicht auf beleidigende Untertöne (sollte es welche geben).
Eine weitere hilfreiche Technik ist das innere Protokoll: Stelle dir vor, du wärst ein Reporter, der sachlich mitschreibt, was gesagt wird. Das schafft Distanz und verhindert, dass dich jedes Wort persönlich verletzt.
🤓 Nachfragen statt rechtfertigen
Dein erster Impuls ist vielleicht, dich zu erklären: „Das stimmt so nicht, ich habe doch nur…“.
Doch wenn du dich sofort rechtfertigst, bleibt kein Raum, das Feedback überhaupt wirken zu lassen. Besser: Nachfragen stellen, um sicherzugehen, dass du richtig verstehst.
Zum Beispiel: „Danke für dein Feedback. Kannst du ein Beispiel nennen, damit ich es besser nachvollziehen kann?“.
Oder: „Was genau hat dich daran gestört?“.
Durch Fragen zeigst du, dass du wirklich interessiert bist – und gewinnst Zeit, das Gehörte zu verdauen. Wichtig: Frag im Sinne von Verstehen wollen, nicht um den anderen auszufragen oder in die Enge zu treiben. Es geht nicht um einen Verteidigungskreuzzug, sondern darum, die Perspektive des Gegenübers zu begreifen.
📝 Sachlich analysieren
Nachdem du das Feedback gehört und Verständnisfragen gestellt hast, nimm dir (sofern möglich) einen Moment Zeit zur Reflexion. Versuch, das Gesagte objektiv zu betrachten:
- Welche Punkte daran sind faktisch richtig?
- Wo hat der andere vielleicht übertrieben oder seine subjektive Meinung kundgetan?
Häufig ist Feedback ein Mix aus Fakten und Wahrnehmungen. Konzentriere dich auf den wahren Kern und die Intention dahinter. Wenn dich z.B. dein Chef harsch kritisiert mit „Ihre Berichte sind immer chaotisch“, steckt vielleicht die berechtigte Aussage drin, dass deine letzten Berichte unklar strukturiert waren. Filtere die hilfreiche Information heraus („Ich sollte an der Struktur meiner Berichte arbeiten“) und lass pauschale Verurteilungen („immer chaotisch“) nicht überbewerten.
Ein nützliches Modell dabei ist das Johari-Fenster. Es unterscheidet unter anderem den blinden Fleck – Dinge, die andere über dich wahrnehmen, die dir selbst aber nicht bewusst sind.
So mancher möchte selbst-bewusster werden. So geschrieben wird klar, dass das mit dem Wissen über uns selbst zu tun hat. Es gibt allerdings in der Selbstwahrnehmung Lücken, Verzerrungen und Schutzmechanismen, die verhindern, dass das Wissen über sich selbst vollständig und "richtig" ist. 1955 entwickelten zwei Amerikaner ein Modell, das in seiner zeitlosen Einfachheit noch heute hilft, das Thema Selbstbewusstsein zu beleuchten und Entwicklung zu ermöglichen. Nutze die Übungen und Anregungen, schätze dich auch selbst ein und werde selbstbewusster. Beitrag: Johari Fenster

Johari Fenster – der einfache, schwere Weg zu mehr Selbstbewusstsein
Durch gezieltes Feedback verkleinert sich dieser blinde Fleck, und deine Selbstwahrnehmung nähert sich der Fremdwahrnehmung an. Mach dir bewusst: Jeder von uns hat solche blinden Flecken. Indem du offen für Feedback bist, entdeckst du neue Seiten an dir und kannst gezielt daran arbeiten. Das ist ein enormer Vorteil! Stell dir vor, niemand würde dir je sagen, dass du z.B. häufig andere unterbrichst – du würdest es vielleicht dein Leben lang tun und Chancen vergeben, es zu ändern.
💡 Tipps für eine resiliente Haltung
Hier eine kleine Checkliste, wie du deine Fähigkeit, Feedback aufzunehmen, stärken kannst:
✅ Dankbarkeit zeigen: Bedanke dich aufrichtig für die Rückmeldung, auch wenn sie kritisch war. Zum Beispiel: „Danke, dass du mir das sagst – ich weiß das zu schätzen.“ Das signalisiert deinem Gegenüber, dass du die Mühe anerkennst. Und es hilft dir selbst, die positive Absicht im Feedback zu sehen.
✅ Nicht persönlich nehmen: Versuche, Kritik nicht als Attacke auf deine Person zu werten, sondern als Kommentar zu einem Verhalten oder Ergebnis. Gerade wenn die Worte hart sind, erinnere dich: Das Feedback beschreibt eine Sache, nicht deinen Wert als Mensch. Dieses Mindset schützt dein Selbstwertgefühl.
✅ Keine vorschnellen Entschuldigungen: Natürlich kannst du dich entschuldigen, wenn ein Fehler passiert ist. Aber entschuldige dich nicht dafür, Feedback bekommen zu haben („Oh Gott, tut mir leid, dass ich so schlecht bin...“). Nimm es stattdessen als Lernchance an. Du musst auch nicht in der Sekunde alle Lösungen parat haben. Es ist okay zu sagen: „Ich denke darüber nach und komme gerne nochmal darauf zurück.“
✅ Um Beispiele bitten: Wenn das Feedback vage ist („Du bist nicht engagiert genug“), bitte höflich um konkrete Beispiele: „Kannst du mir Situationen nennen, in denen dir das aufgefallen ist?“. Das sorgt dafür, dass die Rückmeldung greifbar wird und du wirklich etwas damit anfangen kannst.
✅ Die 3-Trigger-Kenntnis: Die Harvard-Experten Douglas Stone und Sheila Heen identifizieren in ihrem Buch "Danke für das Feedback" drei typische Auslöser, warum wir Feedback manchmal automatisch abwehren:
- Sachlicher Trigger (Truth Trigger): Wir glauben, die inhaltliche Kritik ist unberechtigt oder falsch – das macht uns wütend.
- Beziehungs-Trigger: Wir haben ein Problem mit dem Feedbackgeber (z.B. „Der hat selbst keine Ahnung!“) – und lehnen deshalb das Feedback ab.
- Identitäts-Trigger: Das Feedback erschüttert unser Selbstbild („Bin ich wirklich so?“) und verletzt uns.
Erkennst du, welcher Trigger bei dir gerade angeschlagen hat, kannst du bewusster damit umgehen. Beispiel: „Okay, ich reagiere gerade so sauer, weil ich finde, die Kritik ist unfair dargestellt…“ – schon dieses Bewusstsein kann helfen, ruhiger zu bleiben. Dann kannst du gezielt nachfragen oder um Zeit bitten, statt impulsiv dichtzumachen. Sich selbst kennen ist hier der Schlüssel.
✅ Growth Mindset kultivieren: Entwickle die Haltung, dass Fähigkeiten formbar sind und Kritik dir hilft, besser zu werden. Mit so einem Wachstumsdenken („Ich kann aus Feedback lernen und mich steigern“) fällt es leichter, auch harte Rückmeldungen als nützlich anzunehmen. Statt zu denken „Ich bin halt nicht gut genug“, denk „Ich bin noch nicht perfekt – und das Feedback zeigt mir, wo ich noch wachsen kann.“
📈 Feedback nutzen, um zu wachsen
Resilienz beim Feedback heißt nicht, alles einfach passiv über sich ergehen zu lassen. Aktiv werden ist gefragt! Hier ein paar letzte Tipps, wie du Feedback optimal für dich nutzt:
- Notizen machen:
Schreib dir wichtige Feedbackpunkte auf – am besten direkt danach, solange es frisch ist. So vergisst du nichts und zeigst dir selbst, dass du es ernst nimmst. - Pläne schmieden:
Überlege dir aus dem Feedback konkrete Änderungsziele. Frage dich: Was genau will ich verbessern? Wie messe ich meinen Fortschritt? Zum Beispiel: „Feedback: ich wirke oft unvorbereitet in Meetings -> Ziel: künftig vor jedem Meeting 30 Minuten vorbereiten und 1x pro Woche Kollegen fragen, ob mein Auftreten klar war.“ Mache es greifbar. - Um Unterstützung bitten:
Du musst nicht allein an allem arbeiten. Wenn dir jemand Feedback gegeben hat, darfst du ruhig um Rat fragen: „Hast du vielleicht eine Idee, wie ich das besser machen könnte?“. Oder bitte einen Kollegen als Sparringspartner, der dich erinnert und ebenfalls Feedback gibt, ob du dich verbessert hast. - Dran bleiben & Fortschritt feiern:
Verfolge deine Entwicklungsziele und checke regelmäßig, wie es läuft. Und ganz wichtig: Feiere Erfolge, auch die kleinen! Wenn du z.B. durch Feedback dein Zeitmanagement verbessert hast, gönn dir Anerkennung: „Cool, diese Woche alle Aufgaben pünktlich erledigt – es wirkt!“. Teile das auch gerne mit der Person, die dir das Feedback gab: „Dein Hinweis hat echt geholfen, danke nochmal!“ – das schließt den Kreis positiv. - Feedback einholen:
Warte nicht immer, bis andere von sich aus was sagen. Frag aktiv nach Feedback! Viele Vorgesetzte oder Kollegen zögern, kritische Dinge anzusprechen, bis man sie direkt bittet. Ein einfaches „Ich möchte mich verbessern – hast du einen Tipp für mich?“ öffnet oft Türen. Dadurch zeigst du Lernbereitschaft und bekommst vielleicht Hinweise, die dir sonst verborgen geblieben wären.
Besondere Herausforderung: Manchmal ist Feedback schlicht unfair oder unsachlich. Auch darauf darfst du reagieren – resilient heißt nicht, alles blind zu schlucken. Wenn dich jemand zum Beispiel vor versammelter Mannschaft runtermacht oder Feedback als Waffe einsetzt, ist es legitim zu sagen: „Ich würde das gern unter vier Augen besprechen, hier und jetzt empfinde ich es als unangemessen.“ oder „Ich nehme Ihre Punkte ernst, aber bitte bleiben wir sachlich.“ – in der Ich-Form, aber bestimmt. Resilienz bedeutet nämlich auch, sich selbst zu schützen. Du kannst Feedback freundlich ablehnen, wenn Zeitpunkt oder Ton völlig daneben sind, und um ein angemessenes Gespräch bitten.
Am Ende macht dich eine offene Feedback-Haltung stärker und gelassener. Du merkst, dass Kritik dich nicht zerstört, sondern dass du daran wachsen kannst. Und du nimmst das Steuer in die Hand: Statt dich von jedem Lob oder Tadel aus der Bahn werfen zu lassen, nutzt du Feedback proaktiv zur persönlichen Entwicklung. So wirst du Schritt für Schritt besser – und behältst deine mentale Balance.
Ein hilfreiches Bild
Denk dran: Diamanten entstehen unter Druck – konstruktives Feedback ist genau dieser formende Druck, der aus einem Rohdiamanten einen geschliffenen Edelstein machen kann. 💎
Feedback in digitalen Zeiten: Chancen & Herausforderungen
Wir leben in einer digitalen Arbeitswelt: Meetings per Zoom, Abstimmungen via Chat, Projekttools in der Cloud. Wie beeinflusst das eigentlich das Geben und Nehmen von Feedback? Hier warten neue Chancen, aber auch besondere Stolpersteine. Schauen wir uns an, wie Feedback in Zeiten von Homeoffice, E-Mail & Co gelingt.
🌐 Überall und jederzeit – Fluch und Segen
Früher fand Feedback vielleicht im persönlichen Vieraugengespräch im Büro statt. Heute kann Feedback über viele Kanäle kommen:
- Eine schnelle WhatsApp-Nachricht,
- ein Kommentar im Google Doc,
- ein spontaner Video-Call.
Chance: Feedback lässt sich nahtlos in den Arbeitsfluss integrieren. Du kannst z.B. einem Teammitglied direkt im Dokument einen konstruktiven Kommentar hinterlassen („Hier wäre eine Grafik hilfreich zur Erklärung.“). Solche Inline-Feedbacks passieren zeitnah und genau dort, wo sie relevant sind. Außerdem können digitale Tools Feedback historisch festhalten – man kann also Entwicklungen über die Zeit nachverfolgen.
Herausforderung: Die fehlende persönliche Ebene.
Geschriebenes Feedback hat keine Mimik und Tonlage. Schnell kann ein knappes „Bitte genauer arbeiten.“ im Chat harscher rüberkommen als gemeint. Ironie oder Warmherzigkeit übertragen sich schlecht in Textform.
Missverständnisse sind vorprogrammiert, wenn man nicht aufpasst.
Daher gilt:
Wichtige oder kritische Feedbacks lieber mündlich, z.B. per Telefon oder Video-Meeting.
Wenn es doch schriftlich sein muss, wähle Worte und Emojis mit Bedacht: Ein 🙂 kann z.B. signalisieren, dass etwas freundlich gemeint ist. Und lies deine Nachricht vor dem Absenden nochmal mit den Augen des Empfängers.
📱 Remote Work: Isolation vermeiden, Verbindung fördern
Im Homeoffice fühlen sich viele wie auf einer Insel. Feedback kann hier zum Rettungsanker werden. Daher empfehlen Experten tägliche oder wöchentliche Check-ins im Team. Ein virtuelles Stand-up Meeting am Morgen, wo jeder kurz sagt, woran er arbeitet, kann schon Feedback-Momente bieten („Braucht jemand Hilfe? Gestern fand ich deine Präsentation super, Maria.“). Niemand sollte das Gefühl haben, im stillen Kämmerlein zu verschwinden.
Tipp:
- Etabliert virtuelle Kaffeepausen oder Lunch-Treffen, wo locker geplaudert wird. Oft ergeben sich daraus spontan Rückmeldungen und Ideen, wie im echten Büro.
- Auch ein Team-Chat nur für ToDos und Erfolge kann die Feedbackkultur stärken – z.B. ein WhatsApp-Kanal #DailyPraise, in dem jeder Kollegen für kleine Dinge loben kann.
Solche Rituale halten die Zwischenmenschlichkeit am Leben, die sonst auf der Strecke bleibt.
💻 Feedback-Kultur in digitalen Teams
In verteilten Teams muss man Feedback bewusst einplanen. Regelmäßige 1:1-Gespräche per Video zwischen Führungskraft und Mitarbeiter sind ein Muss, um ausführliches Feedback zu geben und zu holen. Hier sollte Raum sein für Fragen wie:
- „Wie geht’s dir mit der aktuellen Arbeitsbelastung?“
- „Was lief letzte Woche gut/schlecht?“
– also nicht nur Aufgaben durchsprechen, sondern gezielt Meta-Feedback einholen. Wichtig:
Vertraulichkeit & Offenheit sicherstellen.
In einem Videocall ohne Störungen kann man genauso gut tiefgehendes Feedback austauschen wie in Präsenz – manchmal sogar besser, weil man nicht im selben Raum sitzt und sich direkter in die Augen schaut (manchen fällt Offenheit so leichter).
Chancen durch Tools
Moderne Collaboration-Tools bieten eingebaute Feedbackfunktionen. Etwa kann man in Projektmanagement-Softwares Aufgaben abschließen und einen kurzen „Was lief gut/ Lessons Learned“ Kommentar hinterlassen.
Es gibt auch spezielle Feedback-Apps für Teams, wo Mitglieder anonym Feedback geben können oder in spielerischer Form (z.B. durch Gamification – Punkte vergeben für gutes Teamwork). Diese Möglichkeiten können Hemmschwellen senken, besonders in kulturell gemischten Teams, wo direktes Ansprechen schwierig ist.
Allerdings sollte Anonymität mit Vorsicht genutzt werden: Sie kann ehrlichere Antworten fördern, aber auch zu weniger Verantwortung führen bei den Feedbackgebern.
Ein guter Weg ist, anonyme Umfragen als Stimmungsbarometer zu nutzen, aber individuelle Themen trotzdem persönlich zu besprechen.
😓 Digitaler Stress und Empathie: Regeln aufbauen
Ein oft übersehener Aspekt: Digitaler Feedback-Stress. Ständig ploppen Benachrichtigungen auf – jede kann potenziell Feedback enthalten. Manche fühlen sich, als würden sie permanent beobachtet. Hier hilft es, als Team Spielregeln festzulegen: Zum Beispiel, dass nach Feierabend kein kritisches Feedback mehr verschickt wird, um niemanden schlaflos zu machen. Oder dass Feedback-Nachrichten im Messenger mit einem Kürzel beginnen wie "[Feedback]" – so kann der Empfänger entscheiden, wann er das in Ruhe liest.
Empathie ist online noch wichtiger: Frag dich vor dem Absenden, wie deine Botschaft ankommen könnte. Und wenn du Feedback empfängst und unsicher bist, wie es gemeint war, zögere nicht, telefonisch nachzufragen, statt im Stillen zu grübeln.
Besondere Herausforderung „Distance Bias“
Untersuchungen zeigen, dass wir im Homeoffice teils weniger Feedback bekommen, einfach weil wir weniger sichtbar sind. Führungskräften rutscht positives Feedback eher durch, wenn sie die Mitarbeiter nicht täglich sehen.
Hier darfst du ruhig proaktiv sein und Feedback einfordern, wenn du im Dunkeln tappst: „Können wir uns mal abstimmen, ob das Projekt in deinem Sinne läuft?“. Führungskräfte sollten sich bewusst Zeit nehmen, remote Lob auszusprechen, etwa in Teamcalls Erfolge hervorheben – auch das ist Feedback.
🔄 Neues Lernen erfordert Feedback – auch digital
Nicht zu vergessen: In digitalen Lernsettings (E-Learning, Online-Kurse) ist Feedback ebenfalls der Schlüssel. Lernende brauchen Rückmeldung zu ihren Aufgaben, sonst lernen sie ineffizient. Hier kommen KI und Automatisierung ins Spiel: Schon jetzt geben E-Learning-Plattformen automatisches Feedback bei Quizzen oder simulieren Dialoge.
Das ist hilfreich, ersetzt aber kein menschliches Coaching. Die Zukunft könnte Kombinationen bringen: KI-Tools, die als Feedback-Coaches fungieren (z.B. deine Präsentation analysieren und Tipps geben), plus menschliche Mentoren, die das Feinfühlige übernehmen.
Trend: Manche Unternehmen experimentieren mit asynchronem Video-Feedback – Mitarbeiter nehmen ein Video auf, z.B. einer Präsentation, und Kollegen geben zeitversetzt per Kommentar Feedback. Das ist flexibel und man kann sich gut überlegen, was man sagt. Diese Methoden werden im Zeitalter global verteilter Teams vermutlich zunehmen.
Fazit zu Feedback in digitalen Zeiten
Die digitale Welt bietet uns viel mehr Kanäle und Gelegenheiten für Feedback. Die Kunst besteht darin, diese bewusst und klug zu nutzen: Den richtigen Kanal für den richtigen Anlass wählen (Kritik lieber persönlich als per Mail), Regelmäßigkeit reinbringen, aber auch Grenzen setzen, damit niemand im Feedback-Dauerfeuer ausbrennt. Mit Empathie, klaren Abmachungen und der Bereitschaft, neue Tools auszuprobieren, kann Feedback auch virtuell richtig gut funktionieren. Dann werden Distanz und Technik zur Nebensache – und das Menschliche rückt wieder in den Vordergrund, wo es hingehört.
Fehler beim Feedback – und wie du sie vermeidest
Auch mit den besten Absichten kann beim Feedback einiges schiefgehen. Hier sind typische Fehlerfallen – und Tipps, wie du sie umschiffst. Keine Angst, selbst erfahrene Chefs tappen mal hinein. Wichtig ist, dass du die Warnsignale kennst:
❌ Fehler 1: Die „Sandwich-Methode“ überstrapazieren
Vielleicht hast du schon vom Feedback-Sandwich gehört: Erst Lob, dann Kritik, dann wieder Lob – quasi Kritik zwischen zwei Brötchenhälften aus Lob verstecken. Klingt nett, oder?
In Wahrheit ist das oft ein Schuss nach hinten. Empathische Menschen durchschauen diese Taktik schnell und erwarten nach jedem Lob den Schlag.
Wer öfter solches „Sandwich-Feedback“ bekommt, hört bei Lob schon gar nicht mehr richtig hin, weil er nur auf die versteckte Klatsche wartet. Das Lob verliert an Wert, die Kritik wird verwässert.
Besser: Natürlich darfst (und sollst) du Positives erwähnen, aber sei ehrlich in der Reihenfolge. Wenn etwas nicht gut lief, verpacke es nicht zwanghaft in Süßholzraspeln. Sprich die Kritik klar an, und danach kann man immer noch positive Aspekte oder gemeinsame Lösungsansätze besprechen. So bleibt dein Feedback authentisch.
Ein echtes Lob zur richtigen Zeit wirkt viel stärker als drei pflichtschuldige Alibi-Lobfloskeln rund um eine Kritik.
❌ Fehler 2: Ungefragt und unpassend Feedback geben
Stell dir vor, du hältst gerade eine wichtige Präsentation, und mittendrin ruft ein Kollege rein: „Sprich lauter!“ – Auch wenn der Inhalt stimmt, ist der Zeitpunkt katastrophal. Feedback zum falschen Moment (oder Ort) kann bloßstellen und demotivieren.
Ebenso unangenehm: öffentliches Kritisieren vor anderen.
Grundregel:
Kritisches Feedback immer unter vier Augen, es sei denn, es wurde explizit anders vereinbart.
Und: nicht in akuten Stresssituationen. Wenn die Emotionen hochkochen – sei es im Streit mit dem Partner oder im Team nach einem Fehlgeschlag – ist sofortiges Feedback oft Gift. Besser erst abkühlen, später in Ruhe reden.
Warte aber auch nicht ewig: Feedback, das zu spät kommt, verpufft (wie wir wissen: Kritik möglichst innerhalb von 3 Tagen).
Ideales Timing: zeitnah, aber mit genug Abstand, dass alle Beteiligten empfangsbereit sind.
❌ Fehler 3: Personalisieren und pauschalisieren
„Du bist halt chaotisch.“ – Solche Angriffe auf die Person sind pures Gift. Feedback sollte sich immer auf das Verhalten oder die Sache beziehen, nie auf Charaktereigenschaften. Sobald du Sätze sagst wie „Du bist…“ (…faul, arrogant, unorganisiert), fühlt sich der andere in seiner ganzen Person abgewertet.
Besser: „Dein Bericht hatte mehrere Rechtschreibfehler“ statt „Du bist schlampig“.
Ebenso problematisch sind Verallgemeinerungen wie „immer“ und „nie“: „Du bist immer zu spät.“ – Meist stimmt das faktisch nicht und der andere wird mit Leichtigkeit Gegenbeispiele finden („Gestern war ich pünktlich!“). Solche Übertreibungen lenken vom eigentlichen Feedback ab und führen zu Abwehrhaltungen.
Tipp:
Bleib spezifisch und beschreibe eine konkrete Situation.
Nicht „Du hörst mir nie zu“, sondern „Gestern im Meeting hatte ich den Eindruck, du warst mit deinen Gedanken woanders, weil…“. Dadurch fühlt sich niemand an die Wand gestellt.
❌ Fehler 4: Zu viel auf einmal
Feuer frei? Lieber nicht. Wenn du jemandem einen Rundumschlag an Kritikpunkten an den Kopf wirfst, überforderst du ihn völlig.
Vielleicht kennst du das aus Streitgesprächen, wenn plötzlich das Phrasenschwein rausgeholt wird: „Und außerdem hast du letztes Jahr… und überhaupt machst du immer…“. Unser Gehirn kann nur begrenzt Kritik aufnehmen, bevor es dichtmacht.
Besser: Fokussiere dich auf ein bis maximal drei Kernpunkte pro Feedback-Gespräch. Priorisiere, was wirklich wichtig ist. Alles andere kann man zu einem späteren Zeitpunkt ansprechen. So hat der Empfänger die Chance, sich auf die wesentlichen Verbesserungsmöglichkeiten zu konzentrieren, statt erschlagen zu werden.
Merke: Qualität vor Quantität – lieber wenige Punkte klar vermitteln als eine Litanei an Mängeln aufzählen.
❌ Fehler 5: Kein Raum für Reaktion
Du hast alles Wichtige gesagt – und dann? Einfach umdrehen und gehen wäre fatal. Ein häufiger Fehler: Feedback als einseitige Ansage abfeuern, ohne dem anderen eine Chance zur Stellungnahme zu geben. Das fühlt sich für den Gegenüber entmündigend an und erzeugt Frust.
Selbst wenn du in Eile bist, plane ein paar Minuten ein, damit dein Feedback-Partner reagieren kann. Vielleicht möchte er Hintergründe erklären, Missverständnisse klären oder gemeinsam überlegen, wie es besser geht.
Diese Dialogphase ist Gold wert: Sie stellt sicher, dass dein Feedback korrekt verstanden wurde und signalisiert gleichzeitig Respekt: „Deine Sicht ist mir auch wichtig.“
Nimm ein Feedback-Gespräch also nie als Monolog. Frag z.B. am Ende: „Wie siehst du das? Ergibt das für dich Sinn?“ – und höre aktiv zu, was kommt. Oft lernst auch du dabei noch etwas über die Situation.
❌ Fehler 6: Falsche innere Haltung – Feedback ohne Wertschätzung
Man spürt es: Wie du innerlich zum anderen stehst, schimmert in deinem Feedback durch. Wenn du genervt, wütend oder überheblich bist, wird selbst höflich formuliertes Feedback seinen Zweck verfehlen.
Beispiel: Ein Vorgesetzter, der insgeheim denkt „Der ist eh unfähig“, kann noch so sehr versuchen, konstruktiv zu klingen – der Mitarbeiter wird die Herablassung zwischen den Zeilen merken.
Beim Feedback geben sollte man die Haltung haben, dass man dem anderen ein Geschenk macht, schreibt das Hanseatische Institut treffend. #
Haltung prüfen: Gehe ich mit dem Wunsch in das Gespräch, dem anderen zu helfen? Oder will ich eigentlich Dampf ablassen? Falls Letzteres, lieber vertagen. Lösungsorientierung und Empathie sollten deine Leitsterne sein. Sprich mit dem Kollegen, nicht über ihn. Wenn du merkst, dass alte Groll oder „Recht haben wollen“ im Spiel sind, halte kurz inne und besinne dich auf das eigentliche Ziel: gemeinsam Verbesserungen finden.
Diese innere Haltung macht oft den Unterschied zwischen Feedback, das ankommt, und Feedback, das “aus Prinzip” abgelehnt wird.
❌ Fehler 7: Fehlende Rückfragen und Nachbetreuung
Feedback ist kein Hit-and-Run-Event. Ein häufiger Fehler: Nach dem Feedbackgespräch nie wieder darüber reden. Besser ist, nach einiger Zeit nochmal locker nachzufragen: „Wie läuft es mit der Umstellung? Kommst du zurecht, brauchst du Unterstützung?“.
Dieses Follow-up zeigt, dass dir das Thema wirklich wichtig war und dass du bereit bist zu helfen. Fehlt diese Nachbetreuung, können zwei Dinge passieren: Der Feedbacknehmer fühlt sich alleingelassen („Toll, jetzt soll ich sehen, wie ich klarkomme“), oder er schiebt die Sache auf die lange Bank, weil er denkt, es sei eh egal.
Idee: Wenn ihr konkrete Maßnahmen vereinbart habt, setzt einen kurzen Termin in einigen Wochen, um den Fortschritt zu besprechen. Natürlich ohne Drohkulisse, sondern unterstützend. So entwickelt sich Feedback zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, statt einem einmaligen Ereignis.
Zusammengefasst:
Fehler beim Feedback geben passieren jedem mal. Wichtig ist, dass du daraus lernst. Beobachte dich selbst: Welche Rückmeldungen von dir kamen nicht gut an? Analysiere, woran es lag – vielleicht einer der obigen Punkte? Hol dir ruhig Meta-Feedback: Frag Kollegen, wie dein Feedback-Stil wahrgenommen wird. Das erfordert Mut, zahlt sich aber aus. Wenn du die häufigsten Fehler vermeidest, steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass deine Botschaft richtig ankommt – nämlich als das, was sie sein soll: eine konstruktive Hilfe und kein Angriff. So wird Feedback wirklich zum positiven Werkzeug und nicht zum Auslöser von Frust.
(Schon gewusst? Oben verlinkte Studie von Gallup ergab, dass nur 26 % der Mitarbeiter die erhaltenen Feedbacks wirklich hilfreich finden. Oft liegt das daran, dass Feedback falsch verpackt oder zur falschen Zeit gegeben wurde. Indem du die obigen Fehler vermeidest, gehörst du zu der Minderheit, deren Feedback wirklich etwas bewirkt! ✨)
Kulturelle Unterschiede beim Feedback
Nicht überall auf der Welt wird mit Feedback gleich umgegangen. Was in New York als klare Ansage gilt, kann in Tokio als Affront empfunden werden. Kulturelle Unterschiede spielen eine große Rolle dabei, wie Feedback gegeben und aufgenommen wird. Wer im internationalen Umfeld arbeitet – oder auch einfach in multikulturellen Teams – sollte diese Unterschiede kennen. Schauen wir uns ein paar Beispiele und Dimensionen an:
🌍 Direkt vs. Indirekt
In manchen Kulturen ist direkte Kritik normal und wird geschätzt – man gilt als ehrlich. In anderen wird Kritik lieber indirekt geäußert, um die Harmonie zu wahren.
Beispiel USA vs. Deutschland: Amerikaner sind bekannt dafür, Feedback diplomatischer zu formulieren, oft eingerahmt von positiven Bemerkungen. Ein US-Manager wird eher sagen „Good job overall, just one minor thing to improve…“, während ein deutscher Chef direkt meint „Das war nicht gut.“ Ohne böse Absicht – in Deutschland ist direktes Feedback oft ein Zeichen von Vertrauen in die Professionalität des Gegenübers. Amerikaner hingegen könnten die deutsche Offenheit als brüskierend empfinden, ebenso wie Deutsche die vielen netten Worte der Amerikaner manchmal als aufgesetzt oder „unehrlich“ empfinden.
Best Practice in internationalen Teams: Mach dir bewusst, was der andere gewohnt ist. Passe deinen Stil flexibel an: Mitarbeiter in den USA schätzen zunächst ein positives Statement, bevor Kritik kommt, während ein deutscher Mitarbeiter direktere Worte bevorzugt und blumige Nettigkeiten davor u.U. als unangenehm empfindet. Es geht darum, dass dein Feedback ankommt. Wenn du weißt, dein Gegenüber tickt kulturell anders, hilf ein bisschen entgegen – ohne dich zu verstellen.
🤝 Individualismus vs. Kollektivismus
Hier geht es darum, ob die Kultur stärker das Individuum oder die Gruppe betont. In individualistischen Kulturen (z.B. Deutschland, USA) wird Feedback tendenziell personenbezogen gegeben: man spricht direkt die individuelle Leistung an – „Dein Beitrag war herausragend“ oder „Du solltest an deiner XY-Fähigkeit arbeiten“. In kollektivistisch geprägten Kulturen (etwa Japan, viele arabische oder afrikanische Länder) achtet man mehr auf die Gesichtswarung der Gruppe.
Feedback wird dort oft verallgemeinert formuliert: statt „Hans hat einen Fehler gemacht“ sagt der Chef „Wir müssen darauf achten, dass keine Fehler passieren“, selbst wenn klar ist, wer es war. Lob wird ebenfalls eher ans Team adressiert, um niemanden herauszuheben.
Dahinter steckt das Prinzip der Harmonie: Offene Kritik an Einzelpersonen – vor allem negative – könnte die soziale Balance stören. Wer aus so einer Kultur kommt, wird direkte persönliche Kritik möglicherweise als unnötig verletzend empfinden, während umgekehrt jemand aus individualistischer Kultur indirektes Gruppenkritik-Feedback als ausweichend oder unaufrichtig sehen könnte.
Tipp: In internationalen Teams kann man die Regeln ruhig transparent machen: Erkläre z.B., dass bei euch direktes, sachliches Feedback üblich ist und als positiv gemeint ist – und frag im Zweifel Kollegen aus anderen Ländern, wie sie es gern hätten. Das zeigt Respekt und verhindert Missverständnisse.
🏅 Hierarchie und Machtdistanz
Eine weitere Kultur-Dimension: Machtdistanz. In Ländern mit hoher Machtdistanz (z.B. viele asiatische, afrikanische oder lateinamerikanische Länder) ist die Hierarchie stark ausgeprägt. Offenes Feedback „nach oben“ – also Untergebene kritisieren den Chef – wird dort selten praktiziert. Es wäre respektlos oder zu riskant, den Vorgesetzten offen zu kritisieren.
Man erwartet eher, dass Kritik von oben nach unten fließt, und selbst die wird oft formeller gehalten.
In Kulturen mit flacher Hierarchie (z.B. Skandinavien, Niederlande) ist hingegen direktes Feedback auch an Chefs normal – man begegnet sich eher auf Augenhöhe. Wer aus einer Hierarchiekultur kommt, könnte es irritierend finden, wenn ein Junior offen den Manager kritisiert (auch wenn erwünscht). Umgekehrt empfindet jemand aus einer egalitären Kultur vielleicht einen asiatischen Kollegen als zurückhaltend oder unbeteiligt, obwohl dieser nur aus Respekt keine offene Kritik übt.
Als internationale Führungskraft solltest du das beachten: Mitarbeiter aus hoher Machtdistanz-Umgebung werden dir freiwillig kaum negatives Feedback geben. Du musst aktiv geschützte Räume schaffen: z.B. anonyme Umfragen oder vertrauliche Einzelgespräche statt großes Meeting, um ehrliches Feedback zu erhalten. Und umgekehrt: Wenn du selbst in einer Kultur arbeitest, wo Chefs nicht kritisiert werden, halte dich mit direktem Feedback nach oben lieber zurück oder formuliere es extrem diplomatisch bzw. in Form von Fragen.
🎭 Kommunikationsstil: High Context vs. Low Context
Anthropologen unterscheiden High-Context und Low-Context Kulturen. In High-Context Kulturen (z.B. viele ostasiatische Länder) läuft viel Kommunikation implizit, zwischen den Zeilen. Kritik wird oft durch die Blume vermittelt – man erwartet, dass das Gegenüber die Anspielungen versteht, ohne dass man es aussprechen muss. Low-Context Kulturen (z.B. Deutschland, USA) sind expliziter – hier sagt man klar, was Sache ist, weil man nicht auf implizites Deuten vertraut.
Das betrifft Feedback direkt: Ein Chinese könnte Feedback so formulieren: „Vielleicht könnten wir einen anderen Ansatz ausprobieren…“ was eigentlich deutliche Kritik am jetzigen Vorgehen ist. Ein Niederländer würde wahrscheinlich sagen: „Das funktioniert so nicht, wir müssen was anderes machen.“ Wenn diese Welten aufeinander treffen, kann es Verwirrung geben.
Tipp: Bei internationalen Projekten kann es hilfreich sein, Feedback-Spielregeln festzulegen. Etwa: Jeder darf direkt seine Meinung sagen und keiner nimmt’s persönlich – um die Indirekten zu ermutigen, oder umgekehrt: Wir formulieren Kritik erst nach dem Meeting schriftlich – um den Direkten zu bremsen. Wichtig ist, dass alle sich wohlfühlen und verstehen, was gemeint ist.
👥 Kulturelle Missverständnisse erkennen
Eine kleine Anekdote: Ein deutscher Manager lobte seinen indischen Mitarbeiter mit den Worten „Not bad“ für einen Bericht – der Mitarbeiter war geknickt. In Deutschland heißt „nicht schlecht“ oft schon ziemlich gut. In Indien (englischsprachig) wurde es wörtlich verstanden als „na ja, nicht wirklich gut“. Hier prallten unterschiedliche Feedback-Gewohnheiten aufeinander.
Solche Missverständnisse passieren leicht, wenn man die anderen Codes nicht kennt.
Daher: Im Zweifel lieber nachfragen, wie etwas gemeint war, bevor man gekränkt reagiert. Und als Feedbackgeber bei fremden Kulturen ruhig zusätzlich erklären, wie man es meint: „In meinem Land würde man jetzt sagen: Das war in Ordnung, aber es gibt noch Luft nach oben. Und genau so meine ich das auch.“ – Solche Metakommunikation schafft Klarheit.
👵👩 Generationsunterschiede und Diversity
Nicht nur nationale Kulturen, auch Unternehmenskulturen, Generationen und Geschlechter beeinflussen den Feedback-Stil. Ein junges Startup pflegt vielleicht die „Du-Kultur“ und sehr lockeres, häufiges Feedback, während ein alteingesessenes Unternehmen formellere Jahresgespräche bevorzugt.
Generation Z gilt als feedbackhungrig: In Umfragen sagen 66 % der Gen-Z-Youngsters, sie brauchen mindestens alle paar Wochen Feedback vom Chef, um im Job zu bleiben – deutlich mehr als ältere Generationen. Gleichzeitig reagieren Jüngere manchmal sensibler, heißt es – wobei das eher eine Frage der Übung ist.
Männer und Frauen? Einige Studien deuten an, dass Frauen tendenziell mehr positives Sozial-Feedback geben, während Männer direkter kritisieren – aber solche Verallgemeinerungen sind mit Vorsicht zu genießen.
Wichtiger ist: Jede*r hat seinen individuellen Stil und seine Prägung. Der beste Ansatz ist immer, auf den Menschen vor dir einzugehen. Frage ruhig: „Wie hättest du es lieber – ehrliches direkte Kritik oder lieber behutsam?“ Das zeigt Professionalität.
Take-away: Kulturelle Unterschiede bedeuten nicht, dass man sich nie versteht. Sie bedeuten nur, dass wir achtsam übersetzen müssen. Ein und dieselbe Rückmeldung kann in verschiedenen Kontexten anders ankommen. Indem du dir die Mühe machst, die kulturellen Präferenzen deines Gegenübers zu berücksichtigen, verhinderst du Fehlinterpretationen. Das heißt nicht, dass du dich verbiegen musst – aber kleine Anpassungen (Tonfall, Rahmen, Wortwahl) zeigen Respekt und erhöhen die Wirksamkeit deines Feedbacks enorm. So wird Feedback geben zur kleinen interkulturellen Kompetenzübung – die sich aber lohnt, denn du baust Brücken statt Gräben.
(Übrigens: In vielen Sprachen gibt es gar kein direktes Wort für „Feedback“. Oft umschreibt man es mit „Rückmeldung“ (Deutsch), „retroalimentación“ (Spanisch) oder „avis“ (Französisch). Allein das zeigt, dass das Konzept in manchen Kulturen erst durch die Globalisierung richtig Einzug gehalten hat.)
Fazit: Feedback als Beziehungsinstrument begreifen
Zum Schluss wollen wir das große Bild nicht vergessen: Warum tun wir das alles? Warum sich anstrengen, richtig Feedback geben zu lernen, warum annehmen, warum Kultur berücksichtigen? Die Antwort liegt im Wesen des Feedbacks:
Feedback ist ein Beziehungsinstrument.
Stell dir Feedback wie einen Brückenschlag zwischen zwei Menschen vor. Der eine sagt: „So sehe ich dich/so wirkt dein Verhalten auf mich.“ – der andere: „Aha, danke – so hab ich das noch nicht gesehen.“ In diesem Moment entsteht Verständnis. Und Verständnis ist die Grundlage von Vertrauen, Kooperation und Wachstum. Feedback schafft eine Verbindung, wo sonst Stille oder Unwissen herrschen würde.
Wenn wir Feedback geben, zeigen wir Interesse am Gegenüber. Wir sagen implizit: „Du bist mir nicht egal, ich möchte, dass wir besser zusammenarbeiten oder dass du dich weiterentwickelst.“ Wenn wir Feedback nehmen, signalisieren wir: „Deine Meinung ist mir wichtig, ich höre dir zu.“ In beiden Fällen stärken wir die Beziehungsseite in der Kommunikation. Psychologen wissen: Menschen wachsen in Beziehungen. Und Feedback ist ein essentieller Nährstoff für diese Beziehungen – im Beruf wie im Privatleben.
Heißt das, alles ist immer harmonisch? Nein, manchmal knirscht es. Feedback kann emotional sein, unbequem. Aber gerade authentisches, auch mal schwieriges Feedback schafft oft tiefere Beziehungen als ewige oberflächliche Nettigkeit. Denk an die Kollegin, die dir ehrlich gesagt hat, was keiner sich traute – erst warst du sauer, aber später dankbar und ihr Verhältnis wurde enger. Oder an den Chef, der auch mal zugibt: „Danke für das Feedback aus dem Team – ich werde versuchen, mich zu verbessern.“ – So jemand gewinnt enorm an Respekt.
Feedback als Haltung heißt: Wir begreifen Kritik nicht als Angriff, Lob nicht als Manipulation, sondern alles als Teil eines ständigen Austauschs. Teams, die diese Haltung entwickeln, sind die wahren High-Performance-Teams. Sie reden offen, lösen Konflikte konstruktiv und pushen sich gegenseitig zu Höchstleistungen – weil jeder weiß, woran er ist und wo er sich verbessern kann. Und sie feiern gemeinsam Erfolge, weil Lob und Anerkennung ganz natürlich fließen und motivieren.
Für dich persönlich bedeutet es: Wenn du Feedback meistern willst, arbeite sowohl an deinen Kommunikations-Skills als auch an deiner inneren Einstellung. Werde zum Vorbild in deinem Umfeld, indem du aktiv, fair und mit Herz Feedback gibst und offen annimmst. Andere werden sich daran orientieren – Mut und Offenheit sind ansteckend! Schon bald könnten Kollegen sagen: „Mit dir kann man echt gut Dinge besprechen, man weiß woran man ist.“ Das ist ein berufliches Kapital, das unbezahlbar ist.
Ganz wichtig: Feedback ist keine Einbahnstraße, sondern eine Schleife. Gute Führungskräfte z.B. holen sich ständig Feedback von ihren Mitarbeitern, um selbst besser zu werden. Dieses sogenannte „Upward Feedback“ schafft Vertrauen, weil Mitarbeiter sehen: Meine Meinung zählt. In Beziehungen kann Feedback die Liebe vertiefen, wenn beide ehrlich sagen dürfen, was sie brauchen, was sie stört – und daran arbeiten. Es gibt Paare, die ritualisieren Feedback, z.B. in Form eines wöchentlichen Check-ins („Was lief gut zwischen uns? Wo gab es Missverständnisse?“). Das mag technisch klingen, ist aber unglaublich verbindend, weil man nicht jahrelang Groll aufbaut, sondern im Gespräch bleibt.
Am Ende des Tages ist Feedback geben und nehmen eine Kernkompetenz für ein erfolgreiches, zwischenmenschlich reiches Leben. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit mit stetem Wandel brauchen wir mehr denn je die Fähigkeit, schnell zu lernen und uns anzupassen. Feedback liefert dafür die notwendigen Informationen und Impuls zum Lernen. Man könnte sagen: Wer kein Feedback erhält, fährt blind – wer Feedback hat, steuert zielgerichtet. Warum also darauf verzichten?
Mach Feedback zu deinem Verbündeten. Geh bewusst in die nächste Woche und suche kleine Gelegenheiten: dem Kollegen ein konstruktives Feedback geben, deinen Chef um Feedback bitten, im Freundeskreis ehrlich sagen, was du schätzt. Beobachte, was passiert. Ja, es kostet manchmal Überwindung – aber mit jeder Erfahrung wird es leichter und normaler. Stück für Stück entwickelst du dich so zu jemandem, der Feedback kultiviert: In deinem Team, in deiner Familie, überall.
Und wer weiß – vielleicht schaut irgendwann jemand zu dir auf und denkt sich: „Wow, von dieser Person kann ich echt lernen, wie man richtig Feedback gibt!“ 🎉 Dann weißt du: Du hast das Feedback-Geheimnis entschlüsselt – Feedback als mächtiges Beziehungs- und Entwicklungsinstrument verstanden und zu nutzen gelernt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Kompetenz, die dir in einer komplexen Welt immer einen Schritt Vorsprung gibt!
Zum Abschluss: Hab Mut, Feedback zu geben und anzunehmen. Sieh es als Weg, dich mit deiner Umgebung laufend abzugleichen und gemeinsam besser zu werden. Fehler werden korrigierbar, Erfolge sichtbar, Beziehungen enger. Genau das macht das Leben – und die Arbeit – doch letztlich reich und spannend. In diesem Sinne: Viel Erfolg auf deinem Weg, richtig Feedback geben zu lernen! 🚀
blueprints-Pareto-Tipp: Richtig Feedback geben lernen
"Richtig Feedback geben zu lernen ist eine Schlüsselkompetenz, die berufliches und persönliches Wachstum fördert, Beziehungen stärkt und Missverständnisse reduziert. Entscheidend ist, dass Feedback klar, respektvoll, konkret und zukunftsorientiert formuliert wird – immer im Dialog und mit dem Ziel der Weiterentwicklung. Wer Feedback als wertschätzenden Austausch begreift, schafft eine vertrauensvolle Kommunikationskultur und wird langfristig erfolgreicher zusammenarbeiten."
Ergänzungen und Fragen von Leser:innen
Hast du eine Frage zum Beitrag oder etwas zu ergänzen bzw. zu korrigieren?
Hat dir der Beitrag bei deiner Frage zum Thema geholfen? Bitte gib uns Feedback. Jeder kleine Hinweis hilft uns und allen Lesern weiter. Vielen Dank!
Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓
Antwort 1
Geht es auch ohne kleber?
Im Zusammenhang interessant
7 interessante oder überraschende Fakten über Feedback
- In der Antike war Feedback eine rhetorische Disziplin: Schon Aristoteles schrieb über „pathos, logos, ethos“ – indirekt Grundlagen für wertschätzendes Feedback.
- Feedback aktiviert neurologisch das gleiche Hirnareal wie körperlicher Schmerz – daher reagieren Menschen manchmal überempfindlich auf Kritik.
- „Feedback-Fatigue“ ist ein echtes Phänomen: Wer zu oft ungefiltert Rückmeldungen bekommt, kann abstumpfen oder sich emotional ausgelaugt fühlen.
- In vielen asiatischen Unternehmen gibt es keinen Begriff für direktes Kritik-Feedback – stattdessen wird mit Andeutungen gearbeitet, z. B. über den Blick oder höfliches Schweigen.
- (Positives) Feedback kann die Kreativität verdoppeln – Studien zeigen, dass Teams mit häufiger positiver Rückmeldung deutlich mehr Ideen generieren als andere.
- Die beliebte „Sandwich-Methode“ (Lob–Kritik–Lob) wird in über 70 % der Fälle als manipulativ erkannt – Empfänger erwarten bereits das Negative nach dem ersten Lob.
- Die niederländische Luftfahrt nutzt ein standardisiertes Peer-Feedback-Protokoll, um Flugfehler zu vermeiden – es gilt als Vorbild für sicherheitskritische Feedbackkultur in Hochrisikobranchen.
Weiterlesen auf blueprints.de

Johari Fenster – der einfache, schwere Weg zu mehr Selbstbewusstsein
So mancher möchte selbst-bewusster werden. So geschrieben wird klar, dass das mit dem Wissen über uns selbst zu tun hat.
Es gibt allerdings in der Selbstwahrnehmung Lücken, Verzerrungen und Schutzmechanismen, die verhindern, dass das Wissen über sich selbst vollständig und "richtig" ist.
1955 entwickelten zwei Amerikaner ein Modell, das in seiner zeitlosen Einfachheit noch heute hilft, das Thema Selbstbewusstsein zu beleuchten und Entwicklung zu ermöglichen. Nutze die Übungen und Anregungen, schätze dich auch selbst ein und werde selbstbewusster.
Hier weiterlesen: Johari Fenster
Stärken und Schwächen herausfinden

Stärken und Schwächen herausfinden – warum wir sie kennen sollten
- Tagesplan erstellen – die 7 Geheimnisse guter Planung
- Pareto-Prinzip einfach erklärt – wie du das Phänomen nutzt
- Konzentrierter arbeiten – so schaffst du es – Tipps, Apps und mehr
- Pomodoro-Technik – die Arbeit von 40 in 19,5 Stunden verrichten
- Salamitaktik: Schritt für Schritt vorgehen – so gelingt es
- Zeitfresser: Die großen 16 – Wie du deinen Proviant schützt
- E-Mail: effizienter Umgang – Ideen für mehr Zeit und Motivation
- Antizyklisch handeln
- Wie du Aufgaben und Projekte planst – 7 Prinzipien
- In 4 Schritten zur Gewohnheitsänderung
Quellenangaben und weiterführende Links
Übersicht aller verwendeten Quellen und Studien:
- Gallup (2024): How Effective Feedback Fuels Performance – Studie über die Bedeutung von regelmäßigen, sinnvollen Feedback für Mitarbeiter-Engagement (80 % der wöchentlich Feedback-Erhaltenen sind voll engagiert).
- Gallup (2019) https://www.gallup.com/workplace/257582/feedback-not-enough.aspx: Feedback Is Not Enough – Artikel mit Einblicken in häufige Probleme traditionellen Feedbacks (nur 26 % der Mitarbeiter empfinden ihr erhaltenes Feedback als hilfreich).
- Bernd Geropp: Podcast "Führung auf den Punkt gebracht" (Folge Feedback geben und annehmen) – Zitat: „Nur mit Feedback kann man sich weiterentwickeln. Lernen ohne Feedback ist kaum möglich.“
- Fuehrungskompetenz.de – Ratgeberartikel Feedback annehmen – Ratschlag: Nicht verteidigen, sondern verstehen. Zitat: „Feedback ist keine Anklage, sondern eine Einladung, dich weiterzuentwickeln.“
- – 5 häufigste Fehler bei Feedbackgesprächen – Tipp zu Timing: Kritik binnen drei Tagen, Lob binnen einer Woche geben (für maximale Wirkung).
- Ryan Jenkins Blog – How Gen Z Employees Want Feedback – Statistiken: 66 % der Gen Z wollen mindestens alle paar Wochen Feedback vom Vorgesetzten (für hohe Loyalität).
- – Feedbackmethoden – Beschreibung, warum die Sandwich-Methode veraltet ist: Empfänger durchschauen die Taktik, Kritik wird erwartet und Lob entwertet.
- Hanseatisches Institut – 7 typische Fehler beim Feedback – anschauliche Erklärung zur Sandwich-Falle: Konditionierung führt dazu, dass man nach Lob „in Hab-Acht-Stellung“ auf die Kritik wartet.
- VDI Wissensforum – 5 Tipps für Feedback im Homeoffice – Ratschlag: Kritisches Feedback in digitaler Kommunikation möglichst im direkten Gespräch (Video/Telefon) mit Ich-Botschaften geben, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Papershift Blog (2025): Feedback geben – 10 Best Practices – Abschnitt zu kulturellen Unterschieden: Unterschiedliche Präferenzen z.B. USA (erst Positives, dann Kritik) vs. Deutschland (lieber direkt, blumiges Lob wirkt unangenehm).
- Papershift Blog – kulturelle Unterschiede: In hohen Machtdistanz-Kulturen wird offenes Feedback von unten nach oben selten gegeben (Untergebene vermeiden Kritik am Chef).
- Papershift Blog – kulturelle Unterschiede: In kollektivistischen Kulturen wird Feedback eher gruppenbezogen formuliert, um Individuen nicht bloßzustellen (Kritik verallgemeinern, Lob ans Team).
- Soundview Summary von “Thanks for the Feedback” (Stone & Heen) – Erklärung der drei Feedback-Trigger (Truth, Relationship, Identity Trigger), die Abwehrreaktionen auslösen können.
- Gallup (2024) – Nutzen häufiger Feedbacks: Schnelles Feedback ermöglicht agile Anpassungen; tägliches Feedback multipliziert die Motivation (3,6-fach höhere Wahrscheinlichkeit zu herausragender Leistung).
- Fuehrungskompetenz.de – Tipp beim Feedback annehmen: Dankbarkeit zeigen, selbst für kritisches Feedback, um die Wertschätzung für die Mühe des Feedbackgebers auszudrücken.
- Papershift Blog – Empfehlung: Feedback kontextsensitiv geben – bei internationalen Teams Stil anpassen (z.B. geschützte Kanäle für Kulturen mit hoher Machtdistanz, um ehrliches Feedback zu ermöglichen).
- Hanseatisches Institut – Haltung beim Feedback: „die Haltung haben, dass ich dem anderen ein Geschenk gebe“ – wertschätzende Grundeinstellung als Basis.
Zusätzliche Buchempfehlungen und Podcasts zum Thema:
- Dankbarkeit für das Feedback – Douglas Stone & Sheila Heen. Deutscher Titel: “Danke für das Feedback – Die Wissenschaft und Kunst, gutes Feedback zu erhalten.” Ein herausragendes Buch darüber, wie man Feedback annehmen kann. Es beleuchtet psychologische Hintergründe und gibt praxisnahe Tipps, um besser mit Kritik umzugehen.
- Radical Candor – Kim Scott (deutsch: “Radikal offen – Authentisch führen”). Eine ehemalige Google-Führungskraft erklärt, wie Führungskräfte ehrliches, direktes Feedback geben können, ohne Empathie zu verlieren. Mit vielen Beispielen aus der Praxis – ideal für alle, die Teams leiten.
- Keine Regeln – Reed Hastings & Erin Meyer. Dieses Buch über die Kultur beim Streaming-Dienst Netflix enthält ein spannendes Kapitel zum Thema Feedback-Kultur. Netflix praktiziert eine extrem offene Feedbackpolitik. Erin Meyer (bekannt für interkulturelle Forschung) trägt dazu Erkenntnisse bei, wie Feedback in verschiedenen Kulturen gehandhabt wird.
- Podcast: “Führung auf den Punkt gebracht” von Bernd Geropp – Folge FPG014 “Feedback geben und annehmen”. Ein deutscher Führungskräfte-Coach spricht konkret darüber, wie man Mitarbeitern wirksam Feedback gibt und selbst als Chef Feedback erhält. Praktisch und auf den Punkt.
- Podcast: “Female Leadership” von Vera Strauch – Folge “Starkes Feedback”. In dieser Episode geht es darum, wie Feedback uns wachsen lässt und warum es auch mal wehtun darf. Mit weiblicher Perspektive und vielen Tipps, gerade auch für Frauen in Führungspositionen.
- Podcast: “Kommunikation leben” – Folge “Feedback annehmen”. Dieser Podcast (verfügbar auf Apple Podcasts) behandelt Strategien, wie man Feedback konstruktiv annimmt, mit Beispielen und Übungen für die richtige innere Haltung.
- Praxisbuch “Feedback geben” von Jörg Fengler. Ein fundiertes (wenn auch etwas älteres) Werk aus der Beltz-Reihe, das viele Methoden und Kommunikationsmodelle (z.B. Ich-Botschaften, gewaltfreie Kommunikation) für Feedback vorstellt – geeignet für Trainer, Pädagogen und Führungskräfte.
- “Feedback ist ein Geschenk” von Sebastian Mauritz (Haufe Verlag). Dieses Buch legt den Fokus auf die Haltung und Kultur: Wie schafft man ein Umfeld, in dem Feedback selbstverständlich und willkommen ist? Mit vielen Beispielen und auch dem Blick auf Resilienz beim Feedback-Empfangen.
- Tool-Empfehlung: Das Johari-Fenster (online frei verfügbare Übungsblätter oder Apps, siehe auch oben verlinkten Artikel) – eignet sich hervorragend, um im Team blinde Flecken aufzudecken. Indem Teammitglieder sich gegenseitig Eigenschaften zuordnen (aus vorgegebenen Adjektiven), erhält jeder Feedback, was andere an ihm sehen. Ein spielerischer Ansatz, der offen für Feedback macht und die Kommunikation im Team verbessert.
Geschrieben von

Michael Behn
Michael arbeitet als Trainer und Coach im Bereich Kommunikationstraining und Selbstmanagement. Er arbeitet bundesweit für kleine und mittelständische Unternehmen. Schwerpunkt sind Führungstrainings, Verkaufstrainings und das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Er ist Gründer von blueprints, was seit dem Jahr 2000 eine Leidenschaft von ihm ist. -> Michael Behn auf Xing: https://www.xing.com/profile/Michael_Behn/web_profiles ||| Beraterprofil: https://www.behn-friends.de/fileadmin/user_upload/PDF/bf-Trainer-_und_Beraterprofil-Michael-Behn-19U.pdf
- Details
- Geschrieben von: Michael Behn

