-
Carl Friedrich Gauß und Summenformel

Aufgabe: Der siebenjährige Carl Friedrich Gauß und die Summenformel
Es war ein gewöhnlicher Tag in der Schule, als der Lehrer Büttner seinen Schülern eine schwierige Aufgabe stellte: Sie sollten die Zahlen von 1 bis 100 addieren. Die Schüler begannen sofort zu rechnen, zu addieren und zu multiplizieren - es war eine mühsame Aufgabe, die (eigentlich) viel Zeit in Anspruch nehmen sollte.
Aber nicht für den kleinen Carl Friedrich Gauß, der damals erst sieben Jahre alt war. Er schrieb die Summe nach kurzem Überlegen auf und gab das Ergebnis als erster ab.
Wie hat der kleine Gauß das so schnell gerechnet?
-
Prokrustesbett – Bedeutung, Herkunft

Prokrustesbett – wer nicht passt, wird passend gemacht – Bedeutung, Herkunft
Prokrustes war in der griechischen Mythologie ein Riese, der alle, die ihm in die Hände fielen, auf ein normales Bett legte. Waren sie für das Bett zu lang, wurden sie gekürzt. Waren die Gefangenen zu kurz, wurden sie gestreckt. Er machte die Gefangenen passend für das Prokrustesbett, bis er vom König von Athen Theseus getötet wurde.
Im übertragenen Sinn nennen wir heute ein starres Schema, das schmerzhafte Anpassungen erfordert, ein "Prokrustesbett".
Aber auch eine unangenehme Lage, in die jemand hineingezwungen wird, nennen wir "Prokrustesbett".
-
Gimpel - Bedeutung

Gimpel: Definition, Bedeutung, Herkunft, Synonyme und Beispiele
Seine Herkunft führt uns tief zurück ins Althochdeutsche: "Gimpil" nannte man einst einen farbenprächtigen Singvogel mit roter Brust - den wir heute noch als Gimpel oder Dompfaff kennen. Doch mit der Zeit hat der Begriff eine zweite Bedeutung bekommen.
Heute steht "Gimpel" nicht nur für ein Tier, sondern auch für einen Menschen: jemand, der naiv, leichtgläubig oder ein bisschen tapsig durchs Leben geht.
Schon Wilhelm Busch spottete:
„Jung ein Gimpel, alt ein Simpel.“
Ein Simpel ist im Deutschen eine eher salopp oder leicht abwertend gemeinte Bezeichnung für eine Person, die als naiv, einfältig oder geistig unbeholfen wahrgenommen wird.
-
Memento mori – Bedeutung

Memento mori – der Mahnruf an alle – Bedeutung
"Memento mori" war ein lateinischer Mahnruf. Er bedeutet so viel wie "Bedenke, dass du sterblich bist!".
Die Herkunft lässt sich wie folgt erklären. Im antiken Rom gab es das Ritual, dass hinter dem siegreichen Feldherrn beim Triumphzug ein Sklave stand oder ging. Er hielt einen Lorbeerkranz über den Kopf des Siegreichen und mahnte ununterbrochen mit den folgenden Worten:
"Memento mori." (Bedenke, dass du sterben wirst.)
"Memento te hominem esse." (Bedenke, dass du ein Mensch bist.)
"Respice post te, hominem te esse memento." (Sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist.)Jim: "Memento mori, sage ich nur."
John: "Ja, es wäre schön, wenn hinter manchem Politiker jemand stünde und die alten Verse ständig aufsagen würde." -
Einen Korb geben

Einen Korb geben – wie gemein aber manchmal verständlich – Herkunft
Seine Herkunft verdankt die Redewendung "einen Korb geben" bzw. "einen Korb bekommen" der Zeit, in der die Frauen ihre Liebhaber zum Teil mit einem Korb zu sich hinaufziehen ließen.
War der Liebhaber nicht mehr erwünscht, gab man ihm einen Korb mit brüchigem Boden oder ließ ihn in luftiger Höhe einfach hängen, um ihn so dem Gespött der Leute auszusetzen.
Heutige Bedeutung:
Heute verwenden wir diese Redewendung, wenn wir eine ablehnende Antwort auf ein Angebot geben.
Beim Werben um einen Partner wird dieser Ausdruck häufig verwendet - also wenn wir jemandes Liebes- oder Heiratsantrag abweisen.
-
Gedächtnispalast Anleitung

Das Geheimnis von Sherlock Holmes: Der Gedächtnispalast (mit Anleitung)
Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes nutzt in der BBC-Serie eine Gedächtnis-Technik, die von den alten Griechen erfunden wurde – den "Gedächtnispalast". Studien legen nahe, dass jedermann mit dieser uralten Technik sein Gedächtnis drastisch verbessern kann. Die Anwendung macht sogar Spaß.
Wir erläutern dir die erfolgreiche Anwendung eines Gedächtnispalastes anhand von typischen Beispielen. Unten im Text findet sich eine Kurzanleitung als PDF zum Ausdruck.
-
Der Berg kreißte und gebar eine Maus

Der Berg kreißte und gebar eine Maus – Bedeutung
Das Sprichwort "der Berg kreißte und gebar eine Maus" hat seine Herkunft im Werk "Ars poetica" des römischen Dichters Horaz (65 - 8 vor Christus).
In ihm ist zu lesen: "Es kreißen die Berge, zur Welt kommt nur ein lächerliches Mäuschen". So wurde mit einem Schmunzeln darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die Großes ankündigen, Großes versprechen und vorbereiten, aber kaum etwas Sichtbares dabei herauskommt. Das veraltete Wort "kreißen" bedeutet übrigens soviel wie "in den Geburtswehen liegen".
Jim: "Die Politiker wollten doch vor der Wahl die Verwendung aller gesundheitsschädlichen Unkrautvernichtungsmittel verbieten."
John: "Ja, und herausgekommen ist eine zeitliche Begrenzung bei einigen der vielen Mittel. Wie so oft – der Berg kreißte und gebar eine Maus." -
Enfant terrible - Bedeutung

Enfant terrible - Bedeutung, Herkunft und Beispiele für "schreckliches Kind"
"Enfant terrible" - ein Begriff, der im Deutschen genauso gerne verwendet wird wie in seinem Ursprungsland - Frankreich. Wörtlich übersetzt heißt er "schreckliches Kind". Aber hierbei geht es nicht um bockige Dreijährige, die mit dem Löffel in die Suppe hauen. Ein "Enfant terrible" ist jemand, der durch provokantes Verhalten, unkonventionelle Ansichten oder unerwartete Aktionen auffällt - oft zum Leidwesen anderer. Es schwingt manchmal aber auch ein Hauch von Bewunderung mit, dass jemand sich so etwas traut.
Der Begriff "Enfant terrible" erlangte durch den französischen Zeichner Paul Gavarni (1804 - 1866) besondere Bekanntheit. Zwischen 1838 und 1842 veröffentlichte Gavarni eine Serie humoristischer Lithografien unter dem Titel "Les Enfants Terribles". Diese Bildfolgen stellten Kinder dar, die durch ungezogenes oder provokantes Verhalten auffielen. Durch die Popularität dieser Werke fand der Ausdruck "Enfant terrible" Eingang in die Alltagssprache und wurde fortan verwendet, um Personen zu beschreiben, die durch unkonventionelles oder schockierendes Verhalten auffallen.
Später wurde der Begriff auf Erwachsene übertragen, die - ähnlich wie Kinder - gesellschaftliche Normen infrage stellen.
-
Aus dem Schneider sein - Bedeutung und Herkunft

Aus dem Schneider sein - Bedeutung und Herkunft
Der Ausdruck verdankt seine Herkunft dem Skatspiel, wo "Schneider werden" bedeutet, dass man weniger als 30 bzw. 31 Punkte (Augen) hat. Wer beim Skat "aus dem Schneider ist" hat eine Punktezahl von mehr als 30.
Früher war es auch eine sehr ungalante Redewendung für eine Dame, die über 30 Jahre alt ist, und so in der Meinung der Gesellschaft kaum noch für eine Heirat infrage kam.
Es gibt Stimmen, die eine Verbindung zur Schneiderzunft sehen. Schneidern galt früher als einfacher Beruf, der wenig Ansehen genoss. Wer "aus dem Schneider" war, hatte es geschafft, sich sozial oder wirtschaftlich zu verbessern.
Heutige Bedeutung: Heute gebraucht man diese Redewendung, wenn jemand sich einer Verantwortung entziehen konnte bzw. eine schwierige Situation gemeistert hat. Er ist "aus dem Schneider", weil er nichts mehr damit zu tun hat. Für ihn ist das Kapitel abgeschlossen.
-
Zampano - Bedeutung

Zampano - Angeber gab es schon immer - Bedeutung, Herkunft
Die Bezeichnung "Zampano" verdankt ihre Herkunft dem Film La Strada (Das Lied der Straße) des italienischen Regisseurs Federico Fellini. Zampano ist eine der drei Hauptfiguren (gespielt von Anthony Quinn). Er ist ein lautstarker Prahler, der stets Eindruck schinden will und versucht anderen weiszumachen, er könne Unmögliches möglich machen.
Wenn wir heute sagen, dass jemand "den großen Zampano spielt", dann meinen wir, dass der / die Betroffene, zumeist laut und auffällig, scheinbar die Fäden in der Hand hat.
Abgeleitet ist Zampano vom italienischen Wort "zampa" für Pfote oder Tatze und bezeichnet umgangssprachlich die Hand.
-
Kakophonie – Bedeutung

Kakophonie – Bedeutung – das klingt nicht gut, das ist nicht gut
Der Begriff Kakophonie kommt vom altgriechischen "kakós = schlecht" und "phōné = Laut, Ton, Stimme".
Kakophonie = etwas ist/klingt disharmonisch oder schlecht
Das Gegenteil zu Kakophonie ist die Euphonie.
Seine Herkunft verdankt der Begriff "Kakophonie" oder "Kakofonie" dem Bereich der Musik und der Literatur. Hier werden Laute oder Geräusche, die besonders hart, unangenehm oder unästhetisch klingen, als kakophon bezeichnet. Was gestern in der Musik noch als Kakophonie galt, ist kurze Zeit später häufig zum Ohrenschmaus geworden. Man denke nur an Jazz, Rock 'n' Roll oder Zwölftonmusik. Auch in der Klassik galten Werke von Richard Strauss (z. B. Elektra) oder Werke von Dmitri Schostakowitsch als kakophon.
In der Sprachwissenschaft beschreibt Kakophonie schlecht klingende Laut- oder Wortfolgen (Beispiel "Jetztzeit"). In Gedichten werden hart klingende Wörter verwendet, um Kakophonien zu bilden, z. B. Wortzusammensetzungen mit schwer sprechbaren, geräuschstarken Konsonantenhäufungen wie "Strickstrumpf".
Der Begriff Kakophonie wird auch verwendet, um Missklänge und Unstimmigkeiten zwischen Menschen zu beschreiben. So kritisierte der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder im Dezember 2002 Politiker der eigenen Koalition, die über Steuererhöhungen spekulierten, mit den Worten: "Diese Art von Kakophonie sei der gemeinsamen Politik absolut unzuträglich". In dieser Bedeutung von Kakophonie wurde der Begriff im Jahr 2002 zum Wort des Jahres auf den 4. Platz gewählt.
-
Eselsbrücke - Beispiele und Herkunft

Eselsbrücke - Beispiele und Herkunft
Der Esel ist bekannt als störrische Art der Unpaarzeher. So weigert sich das Tier auch meist beharrlich, selbst die kleinsten Wasserläufe zu durchwaten. Daher baute man früher häufig kleine Brücken, um mit den Eseln trotzdem ans Ziel zu gelangen.
Zum Teil scheint es sich mit unserem Gehirn ähnlich zu verhalten. "Es" will manche Dinge scheinbar einfach nicht behalten.
Heute bezeichnet eine "Eselsbrücke" eine Gedächtnishilfe oder einen Merksatz, der es erleichtert, sich komplizierte Informationen zu merken. Eselsbrücken sind in vielen Bereichen nützlich, sei es in der Schule, im Studium oder im Alltag. Sie helfen dabei, Wissen auf einfache Weise zu strukturieren und leichter abzurufen.
Hier findest du einen Leitfaden zum Thema und Beispiele, um sich Wichtiges und Interessantes zu merken.
-
Danaergeschenk - Bedeutung

Danaergeschenk – Bedeutung, Herkunft – das verflixte Geschenk
Der Begriff Danaergeschenk stammt aus der griechischen Mythologie. Als Danaer bezeichnete man im Altertum einen griechischen Stamm der Peloponnes. Bei Homer waren sie ein Teil des Heeres der Achaier.
Sprichwörtlich geworden sind die Danaer durch den römischen Dichter Vergil in Anspielung auf die berühmte List der Achaier mit dem Trojanischen Pferd: "Ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen."
Heute bezeichnet man mit "Danaergeschenk" ein Geschenk, das Unglück mit sich bringtoder sich für den Empfänger als unheilvoll und schadenstiftend erweist.
-
Prinzip Hoffnung – Bedeutung

Prinzip Hoffnung - Bedeutung und Herkunft des hoffnungsfrohen Zweifelns
Herkunft
Ihre Herkunft verdankt die Redensart "Das Prinzip Hoffnung" dem gleichnamigen Hauptwerk des deutschen Philosophen Ernst Bloch (1885 - 1977).
Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx beeinflusst, entfaltet Ernst Bloch im Prinzip Hoffnung eine umfangreiche Philosophie von einer real möglichen Gesellschaftsveränderung (Konkrete Utopie). Er schrieb es 1938 und 1947 im US-amerikanischen Exil.
Bedeutung
Wenn wir heute sagen, dass uns nur "das Prinzip Hoffnung" bleibt, dann zweifeln wir am Erfolg bzw. am guten Ausgang, wollen aber das Beste glauben und hoffen.
Hier findest du weitere Informationen über "Das Prinzip Hoffnung" ► Heutige Verwendung ► Herkunft ► Umfrage ► Synonyme ► Artikel zum Thema "Ideen für die Krise" ► Kurzvita von Ernst Bloch ► Audio zum Prinzip Hoffnung
-
Kugelfuhr – Herkunft

Kugelfuhr – Herkunft und Bedeutung des schwäbischen Begriffs
Der Begriff "Kugelfuhr" (auch Gugelfuhr) wird vor allem im Schwäbischen verwendet. Kugelfuhr Bedeutung:
Kugelfuhr bezeichnet eine schwierige oder umständliche Angelegenheit oder einen mühevollen Weg mit Hindernissen, Verzögerungen etc.
-
Man merkt die Absicht und man ist verstimmt

Man merkt die Absicht und man ist verstimmt | Bedeutung & Herkunft
Wo kommt dieses geflügelte Wort her und wann benutzt man es?
Der Ausspruch "Man merkt die Absicht und man ist verstimmt" hat seine Herkunft im Schauspiel "Torquato Tasso" von Johann Wolfgang von Goethe (II,1). Hier bemerkt der Titelheld: "... und wenn sie auch die Absicht hat, den Freunden wohlzutun, so fühlt man Absicht, und man ist verstimmt."
Heute verwenden wir das Zitat "Man merkt die Absicht und man ist verstimmt", wenn wir ein allzu durchsichtiges Tun kommentieren, in dem man sehr deutlich persönliche Interessen erkennt.
-
Welcher ist der längste innerdeutsche Fluss?

Welcher ist der längste innerdeutsche Fluss?
Gemeint ist die Kilometerzahl, die der Fluss durch Deutschland fließt.
Ist es der Rhein, die Donau, die Weser oder die Elbe?
-
Dasselbe in Grün - Bedeutung

Dasselbe in Grün – Bedeutung und Herkunft
Seine Herkunft hat der Ausdruck "dasselbe in Grün" von einem Fahrzeug der Firma Opel. Der Wagen mit dem schönen Namen Laubfrosch, der 1924 erstmals verkauft wurde, war eine Kopie des französischen Citroën 5CV bzw. 5HP (1921). Die einzige Änderung war die grüne Lackierung.
Man konnte also mit Recht behaupten: Der Wagen der Firma war "dasselbe in Grün!"
Heutzutage wird "dasselbe in Grün" verwendet, um auszudrücken, dass zwei Dinge nahezu identisch sind, abgesehen von einem unwesentlichen Detail, oft der Farbe oder einer oberflächlichen Eigenschaft.
-
Nicht viel Federlesen machen – Bedeutung

Nicht viel Federlesen machen – komm zur Sache – Bedeutung und Herkunft
Herkunft
Seine Herkunft verdankt die Wendung einer Aktivität aus dem Mittelalter. Es galt damals als Schmeichelei, gar als Kriecherei, höhergestellten Personen die "Federchen" oder was sonst noch auf den kostbaren Gewändern der hohen Herren und Damen landete, von ihren Kleidern zu lesen. Es wurden "Federn von den Kleidern gelesen".
Alternative Herkunft: Bei bestimmten Zeremonien, wie zum Beispiel bei Ritterschlägen, wurden Federn als Zeichen von Würde und Ehre verwendet. Ein "Federlesen" war also ein aufwendiges Ritual, das Zeit und Aufmerksamkeit erforderte. Wenn jemand also "nicht viel Federlesen" machte, bedeutete das, dass er oder sie eine Angelegenheit ohne viel Zeremonie oder Aufheben erledigte.
Heutige Verwendung: Wenn wir heute die Redewendung "Nicht viel Federlesen machen" nutzen, dann meinen wir, dass beispielsweise jemand gleich zur Sache kommen soll, wir uns nicht mit Förmlichkeiten aufhalten oder wir beherzt vorgehen wollen.
-
Heller als tausend Sonnen - Herkunft und Bedeutung

Heller als tausend Sonnen – Herkunft und Bedeutung – dann war sie wohl recht hübsch
Seine Herkunft verdankt das geflügelte Wort "heller als tausend Sonnen" der hinduistischen Religion. In ihr wird die Allgöttin Devi als wunderschöne Frau beschrieben, deren Antlitz heller als tausend Sonnen scheint. Es heißt, dass sie durch ihr Blinzeln das Universum neu erschaffen kann.
Bedeutung:
Wenn jemand besonders attraktiv ist, dann sagen wir, sie oder er scheint "heller als tausend Sonnen".
Leider gibt es eine weitere Bedeutung, die durch die beteiligten Forscher an den ersten Atombombentests entstand. Es beschreibt den entstehenden Atomblitz einer gezündeten Atombombe. Das Buch "Heller als Tausend Sonnen" des Berliner Autors Robert Jungk befasst sich genau mit diesem Thema.
-
Eine Schlange am Busen nähren – Bedeutung und Herkunft

Eine Schlange am Busen nähren – keine gute Idee! (Bedeutung und Herkunft der Redensart)
Herkunft
Die Redensart war bereits im Altertum bekannt und verdankt seine Herkunft Äsops Fabel vom Wanderer und der Schlange, wo es heißt: "Er hatte Mitleid mit der erstarrten Schlange und barg sie an seinem Busen, um sie zu erwärmen". Die Fabel findet sich unten.
Bedeutung
"Eine Schlange am Busen nähren" bzw. wärmen oder erziehen bedeutet so viel wie:
Jemandem Gutes tun, den man für seinen Freund hält, der sich aber später als undankbar und verräterisch erweist.
Hier findest du "Eine Schlange am Busen nähren" weiter erläutert ► Beispiele für die heutige Verwendung ► Herkunft ► Umfrage zur Redensart ► Synonyme ► Artikel zum Thema Freunde ► mehr über Aesop
-
Mea culpa - Bedeutung

Mea culpa – durch meine Schuld – Bedeutung, Herkunft
Seine Herkunft hat der Ausspruch "mea culpa" im katholischen Schuldbekenntnis (Confiteor). Hier heißt es: "... quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa …"
Aus dem Lateinischen übersetzt heißt es: "… ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken: durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld …"
Beim Beten schlagen sich die Gläubigen zum Zeichen der Reue dabei dreimal an die Brust.
Heute benutzt man den Ausspruch "Mea culpa", um sich für etwas zu entschuldigen - manchmal ist es ernst gemeint und mitunter mit einem "Augenzwinkern", also ironisch.
Beispiel: "Du sagst, dir gefällt diese Erklärung nicht. Mea culpa, mea maxima culpa!"
-
Amazone – Bedeutung

Amazone – Bedeutung, Herkunft & wie war das mit der Fortpflanzung?
Eine Amazone ist in der griechischen Mythologie eine Angehörige des kriegerischen Reiterstammes der Amazonen. Dieses Volk soll den Sagen zufolge in Kleinasien unterwegs gewesen sein und nur aus Frauen bestanden haben.
Heute kann der Begriff Amazone verschiedene weitere Bedeutungen haben:
- Reiterin bzw. Turnierreiterin
- hübsche, sportliche Frau
- betont männlich bzw. selbstbewusst/kämpferisch auftretende Frau
- Figur im Märchenschach
- Asteroid des Hauptgürtels
- Reitkleid für Frauen (veraltet)
- in Amerika verbreiteter Papagei
In den Gräbern von Amazonen fand sich eine aufschlussreiche Besonderheit...
-
Akronym – Bedeutung

Akronym – Bedeutung, Herkunft, Beispiele + Rätsel
Das Akronym (Herkunft von altgriechisch ákros „Spitze, äußerstes Ende“ und ónyma „Name“) ist ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben oder -silben mehrerer Wörter oder aus einem Kompositum gebildet wird und als eigenständiges Wort fungiert (Beispiel: FBI (= Federal Bureau of Investigation) oder Kripo= Kriminalpolizei).
Es handelt sich bei Akronymen um Sonderfälle der Abkürzung, die man in Fach- und Umgangssprache findet, die aber auch gerade in der Internet- bzw. Chatsprache sehr beliebt sind. Wir haben dir interessante Beispiele zusammengestellt und du darfst auch gerne mitraten:
-
Überleben nach der Apokalypse

Überleben nach der Apokalypse & welches Wissen zum Wiederaufbau gebraucht wird
Wenn morgen die Welt unterginge, wie überlebst du die ersten Stunden und Tage, das erste Jahr? Wie würdest du danach die Zivilisation wieder aufbauen? Welche Fähigkeiten benötigt man, wenn alle Vorzüge der Moderne verloren sind? Auf welches Wissen kommt es letztlich wirklich an?
Hier erfährst du, wie Überlebende nach dem Ende der Zivilisation zurechtkommen können und was für Dinge notwendig sind, um eine neue Gesellschaft auf die Beine zu stellen. ► Sofortmaßnahmen ► Die ersten 100 Tage überleben (Liste mit Download) ► Das erste Jahr ► Wissen zum Wiederaufbau ► Nahrungsanbau, Wasser ► Jagd ► Medizinische Versorgung und Hygiene ► Kommunikation und Handel
-
Alma Mater – Bedeutung

Alma Mater – Bedeutung, Herkunft und Beispiele
Alma Mater (lat. alma "nährend, gütig" und mater "Mutter") ist eine im europäischen und nordamerikanischen Raum gebrauchte Bezeichnung für Universitäten bzw. Hochschulen. Da die Studenten dort im übertragenen Sinne mit Bildung und Wissen genährt werden, entstand das Bild der Universität als "nährende/gütige Mutter".
Herkunft und Entwicklung des Begriffs
Zurück geht der Begriff auf das Römische Reich. Dort war die alma mater eine nährende, segenspendende Göttermutter und hieß deswegen oft auch Magna Mater ("große Mutter").
Im Mittelalter wurde der Ausdruck dann häufig für die Gottesmutter Maria gebraucht.
Im bildungssprachlichen Kontext taucht der Begriff dann erstmals im 12. Jahrhundert auf. Die im Jahr 1135 gegründete Universität in Bologna, die älteste Europas, entwickelte damals das Motto "Alma mater studiorum". Davon inspiriert findet sich der Ausdruck Alma Mater noch heute in vielen Universitäten im deutschsprachigen Raum, z. B. bei der Alma Mater Lipsiensis (Universität Leipzig).
-
Als Prügelknabe herhalten – Bedeutung

Als Prügelknabe herhalten – Bedeutung, Herkunft und Beispiele
Wenn jemand für etwas beschuldigt bzw. bestraft wird, das er nicht oder nur mit zu verantworten hat, dann muss er "als Prügelknabe herhalten".
Zur Herkunft: Diese Redewendung kommt aus der Zeit, als an jungen Edelleuten des englischen und französischen Königshauses die übliche Prügelstrafe nicht vollzogen werden durfte. An ihrer Stelle mussten arme Kinder, die für diesen Zweck "gehalten" wurden, die Schläge auf sich nehmen. Der Schuldige musste als Strafe bei der Prozedur zusehen, die von Rechts wegen eigentlich ihm galt.
Heute wird der Ausdruck häufig benutzt um zu beschreiben, dass eine Person oder Personengruppe, besonders oft für Probleme oder negative Vorfälle verantwortlich gemacht (und teils auch bestraft) wird, obwohl die Umstände nicht geklärt sind bzw. er oder sie unschuldig ist.
-
Anagramm – Bedeutung

Anagramm – Bedeutung, Beispiele und Übungen
Ein Anagramm (von griechisch anagráphein = umschreiben) bezeichnet eine Buchstabenfolge, die aus einer anderen Buchstabenfolge nur durch die Umstellung der Buchstaben gebildet wird. Das Anagramm wird auch "Letterwechsel" oder "Schüttelwort" genannt.
Ein Beispiel ist das Wort "Lampe", welches ein Anagramm zu "Ampel" und "Palme" ist. Das Umstellen der Buchstaben nennt man Anagrammieren.
-
Höhle des Löwen - Bedeutung

Höhle des Löwen - Bedeutung, Herkunft - sei ein Fuchs, sonst endet das böse
Die Höhle des Löwen ist ein Ausdruck, der seine Herkunft der Fabel "Der Fuchs und der alte Löwe" des griechischen Dichters Aesop verdankt.
In dieser Fabel fragt der alte Löwe den Fuchs, warum er nicht in die Höhle komme, um ihn zu besuchen. Darauf antwortet der Fuchs: "Weil ich viele Spuren hineinführen aber wenige herauskommen sehe."
Die Höhle des Löwen ist ein Ort, wo wir uns in Gefahr wähnen bzw. in Gefahr sind. Darauf geht auch der Ausspruch zurück: "Die Spuren schrecken ab" - im Sinne eines warnenden Zeichens. Dieser Ausspruch wurde früher oft lateinisch zitiert: "Vestigia terrent."
-
Chauvinist

Chauvinist - Bedeutung, Herkunft, vom Patriot zum Frauenfeind
Der Begriff "Chauvinist" verdankt seine Herkunft Nicolas Chauvin, einem (vermutlich legendären) Rekruten, der Napoléon mit spektakulärer Treue gedient haben soll - angeblich 17-mal verwundet, aber immer noch unerschütterlich loyal. Sein übertriebener Patriotismus wurde in dem Vaudeville La Cocarde tricolore von 1831 karikiert und gilt seither als Ursprung für "Chauvinismus".
Zunächst war Chauvinismus gleichbedeutend mit aggressivem Nationalismus. Jemand, der das eigene Land in den Himmel lobte und andere Nationen herabwürdigte, galt als Chauvinist. Diese Bedeutung blieb lange Zeit bestehen, auch in politischen Debatten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Doch dann kam ein entscheidender Wandel. Ab den 1960er-Jahren, im Zuge der Frauenbewegung, tauchte der Begriff "male chauvinism"auf. Damit waren Männer gemeint, die sich Frauen überlegen fühlten, ihre Leistungen herabsetzten oder sie auf Rollenbilder wie Hausfrau und Mutter reduzierten. Dieser Sprachgebrauch setzte sich rasend schnell durch.
Heutige Bedeutung: Heute denken die meisten Menschen bei "Chauvinist" automatisch an den Männer-Chauvi - den Typen, der sexistische Sprüche klopft, im Büro Frauen übergeht oder im Restaurant selbstverständlich erwartet, dass die Frau die Rechnung nicht anfasst.
-
Geh, wo der Pfeffer wächst - Bedeutung

Geh, wo der Pfeffer wächst - 7.000 km könnten gerade reichen - Bedeutung, Herkunft
Eigentlich müsste es heißen "Geh hin, wo der Pfeffer wächst", aber gesagt wird es häufig anders. Seine Herkunft verdankt diese Redensart jener Zeit, als der Seeweg nach Indien entdeckt wurde. Mit dieser Entdeckung wurden allerlei Gewürze zum Handelsobjekt, wie z. B. der Pfeffer.
Wenn man also eine unangenehme Person dahin wünscht, "wo der Pfeffer wächst", will man sie nach dem entlegensten Ort in der Welt schicken und Indien als Ursprungsland des Pfeffers ist da doch ein idealer Ort - immerhin von Deutschland über 7.000 km entfernt.
Übrigens: Nach der beißenden Wirkung des Pfeffers spricht man auch von "Pfeffern" ("Hineinpfeffern", "Draufpfeffern"), wenn man heftig auf etwas einwirkt, z. B. durch Schlagen, Schießen und Ähnliches.
-
Auf Granit beißen – Bedeutung

Auf Granit beißen – Vorsicht vor Zahnverlust, Bedeutung und Herkunft
"Bei jemandem auf Granit beißen" oder "auf Granit beißen" verdankt seine Herkunft dem grobkristallinen magmatischen Tiefengestein Granit. Es ist eine der härtesten Gesteinsarten. Wenn wir also bei jemandem oder bei etwas auf Granit beißen, dann stoßen wir auf extrem starken Widerstand mit einem Anliegen, einer Idee oder einer Bitte.
-
Immunsystem stärken

Immunsystem stärken: Die 20 Top-Empfehlungen mit Checkliste
In Magazinen, Zeitschriften und Blogs, die sich primär mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, kannst du es immer wieder lesen: Ein starkes und stabiles Immunsystem schützt dich am besten vor Erkältung, Schnupfen und Heiserkeit. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist dies für viele Menschen besonders wichtig.
Was ist das eigentlich, dieses Immunsystem und welchen Einfluss hast du darauf? Was wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus und welche Ereignisse führen zu einer Schwächung? Die Antworten darauf findest du hier.
-
Gegenstände des Alltags
Video: 45 geheime Funktionen von Gegenständen des Alltags
Ganz gewöhnliche Gegenstände aus dem Alltag verbergen geheime Funktionen und Features, von denen nicht viele Menschen wissen. Diese finden sich auch bei dir zu Hause, da gibt es einiges Neues zu entdecken!
Manche der Punkte im Video erschienen uns trivial, aber viele der "geheimen" Funktionen von Alltagsgegenständen haben uns überrascht und fanden wir praktisch. Du wirst manche Produkte nach dem Video sicher ein wenig anders nutzen. Susanne aus dem blueprints Team hat ihren Tacker gleich umgestellt.
Länge: 9 Minuten (in deutscher Sprache)
-
Perlen vor die Säue werfen – Bedeutung

Perlen vor die Säue werfen – Bedeutung – Was sollen die damit?
Das Sprichwort "Perlen vor die Säue werfen" verwenden wir heute, wenn wir wertvolle Dinge an jemanden verschwenden, der diese nicht zu schätzen weiß.
Diese Redewendung verdankt ihre Herkunft der Bibel. Im Evangelium nach Matthäus 7,6 heißt es: "Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.“
Bedeutung des Ausdrucks
In der byzantinischen Kirche wurden "Perlen" interpretiert als das geheiligte Brot, das in kleine Bröckchen zerkrümelt wird, sodass die angegebene Bibelstelle aussagen könnte, dass den Säuen kein geheiligtes Brot vorgeworfen werden soll.
Unsere Deutung: Aus unserer Sicht mahnte Jesus, alles Heilige, also auch Glaubensangelegenheiten, nicht mit den Menschen zu teilen oder zu diskutieren, die es nicht zu schätzen wissen.
-
Manschetten haben – Bedeutung

Manschetten haben – nur für Zärtlinge? Bedeutung, Herkunft
Seine Herkunft verdankt die Redensart "Manschetten haben" den studentischen Kreisen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In dieser Zeit hinderte die Mode der überfallenden Manschetten den Gebrauch des Degens im Kampf. Wer also Manschetten trug, der konnte sich nicht schlagen, sondern war ein "modischer Zärtling" bzw. würde man heute sagen "ein Weichei".
Wenn jemand Angst, Furcht oder allzu großen Respekt hat, sagen wir heute auch: "Er hat Manschetten".
-
Hannemann, geh du voran – Bedeutung, Herkunft

Hannemann, geh du voran – Bedeutung und Herkunft
Herkunft
Der Ausspruch verdankt seine Herkunft dem Schwank von den Sieben Schwaben, der seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts bekannt ist. Die Schwaben werden in der Erzählung als recht tölpelhaft dargestellt. Höhepunkt ist der Kampf der Schwaben mit einem Untier, das sich später als Hase herausstellt: Angesichts eines furchterregenden unbekannten Tieres, das aber wie gesagt in Wirklichkeit ein gewöhnliches Langohr ist, wird der eine der sieben Schwaben aufgefordert:
Hannemann, geh du voran! Du hast die größten Stiefel an, dass dich das Tier nicht beißen kann.
Bedeutung
"Hannemann, geh du voran!" verwenden wir heute als eine Aufforderung zum Vorangehen bzw. bei etwas Unangenehmen den Anfang zu machen.
"Hannemann" ist so auch zu einem Symbol geworden und zwar für diejenigen, die sich nicht trauen, denen der Mut fehlt eine unangenehme Aufgabe zu erledigen oder ein Problem zu lösen. Diese Damen und Herren senden dann lieber den "Hannemann" vorweg.
Hier findest du "Hannemann, geh du voran" weiter erläutert: ► Beispiele für die heutige Verwendung ► Herkunft ► Umfrage ► Synonyme ► Artikel zu "Mut" und "Selbstvertrauen" ► Hintergrundinformationen zu den Sieben Schwaben ► Video und Lied
-
Gegen Windmühlen kämpfen

Bild: Windmühlen von Campo der Criptana an der Ruta de Don Quijote
Gegen Windmühlen kämpfen – Bedeutung und Herkunft der Redewendung
Herkunft
Die Herkunft dieser Redewendung geht zurück auf den Ritter von der traurigen Gestalt Don Quijote aus dem gleichnamigen Roman des spanischen Schriftstellers Miguel de Cervantes Saavedra. Er hält Windmühlen für mächtige, vielarmige Riesen und rennt mit angelegter Lanze gegen sie an, was natürlich übel ausgeht. Don Quijote ist eine der bedeutendsten Figuren des abendländischen Romans.
Bedeutung
Die Metapher "Gegen Windmühlen kämpfen" verwenden wir heute, wenn jemand aussichtslos gegen etwas Übermächtiges kämpft, das jedoch nur in der Einbildung vorhanden bzw. ein Feind ist.
-
Iucundi acti labores – Bedeutung

Iucundi acti labores – Bedeutung | Diese Arbeiten sind einfach angenehm
Seine Herkunft verdankt das geflügelte Wort "Iucundi acti labores" der Schrift "Über das höchste Gut und Übel" des römischen Politikers und Schriftstellers Marcus Tullius Cicero.
Übersetzt bedeutet Iucundi acti labores "angenehm sind die getanen Arbeiten". Manchmal wird es auch übersetzt mit "Überstandene Mühen sind süß." Das deutsche Sprichwort zu diesem Thema lautet: "Nach getaner Arbeit ist gut ruhn".
-
Pünktlich wie die Maurer – Bedeutung

Pünktlich wie die Maurer - Achtung, das kann gefährlich sein! - Bedeutung und Herkunft
Diese Redensart verdankt ihre Herkunft der früher weitverbreiteten Ansicht, dass die Maurer auf die Minute genau die Kelle aus der Hand legen, um Feierabend zu machen.
Diese Berufsneckerei ist auch in die Form von Witzen gefasst worden - so wird beispielsweise erzählt, dass ein Maurer, der in den Rhein gefallen war, zu schwimmen aufhörte und ertrank, als die Glocke vom Kirchturm den Feierabend einläutete.
Heutige Bedeutung
Wenn wir heute sagen "pünktlich wie die Maurer", dann meinen wir, jemand sei sehr pünktlich.
-
Allgemeinwissen heute

Allgemeinwissen heute: wichtiges Wissen im Wandel
Du stehst in der Schlange an der Supermarktkasse und siehst die Schlagzeilen der Zeitschriften. Du hörst beim Abendessen Nachrichten im Fernsehen. Oder vielleicht bist du gerade dabei, eine heiße Diskussion über das Abendessen hinweg zu führen. Egal, in welcher Situation du dich befindest, eines ist sicher: Allgemeinwissen ist auch heute überall und immer gefragt.
Doch was genau gilt eigentlich heutzutage als Allgemeinwissen? Und ist es möglich, in einer Welt, die sich ständig verändert, dauerhaftes Wissen zu erwerben? Wir werfen einen Blick auf dieses spannende Thema und finden heraus, ob das Streben nach neuem Wissen jemals endet.
-
Montagswagen - Bedeutung und Herkunft

Montagswagen - Bedeutung, Herkunft - Vorsicht beim Kauf!
Die oft schlechte handwerkliche Arbeit an Montagen prägte das Sprichwort "Montag(sarbeit) wird nicht wochenalt".
Die Redensart verdankt ihre Herkunft "Montagswagen" der deutschen Industrie und bezieht sich auf Produkte, die am Montag hergestellt wurden - einem Tag, an dem die Arbeiter möglicherweise noch nicht voll motiviert oder noch von der Wochenendruhe beeinflusst sind. Es entstand die Annahme, dass die am Montag hergestellten Produkte, insbesondere Autos, aufgrund von mangelnder Sorgfalt oder Aufmerksamkeit der Arbeiter minderwertiger sein könnten.
Heutige Verwendung: Besitzt ein neues Auto erhebliche Mängel, die nach und nach in Erscheinung treten, so sagt man: "Ich habe mir einen 'Montagswagen' gekauft."
-
Begossener Pudel – Bedeutung

Begossener Pudel – kleinlaut oder beschämt dastehen – Bedeutung und Herkunft
Der Begriff "Begossener Pudel" ist eine Redensart, die wir verwenden, um jemanden zu beschreiben, der niedergeschlagen, enttäuscht oder beschämt wirkt.
Der Ausdruck "Begossener Pudel" verdankt seine Herkunft dem 19. Jahrhundert, in der die Hunderasse Pudel beliebte Begleithunde und oft auch Statussymbole waren. Sie wurden für ihre Intelligenz und ihr freundliches Wesen geschätzt, aber auch für ihr charakteristisches Fell, das in vielen Fällen zu kunstvollen Frisuren geschnitten wurde.
Wenn ein Pudel jedoch nass wurde, verlor er sein stolzes Aussehen. Das normalerweise flauschige Fell lag platt an, und der Hund wirkte bedrückt und unglücklich. Dieser Anblick führte schließlich zur Entstehung der Redensart "wie ein begossener Pudel dastehen", um jemanden zu beschreiben, der so wirkt, als wäre er in einer unangenehmen oder peinlichen Situation.
Der Name Pudel wurde im 18. Jahrhundert übrigens aus Pudelhund gekürzt.
-
Avalon – Bedeutung, Herkunft und Mythos
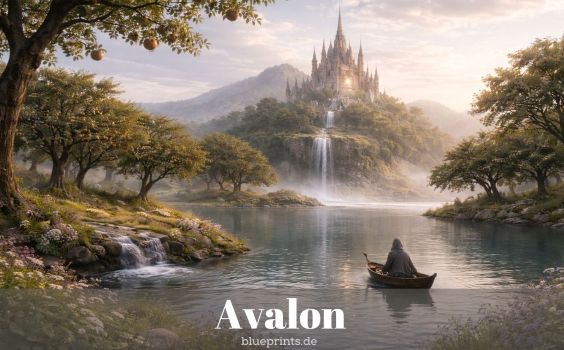
Avalon – Bedeutung, Herkunft und Mythos: ein Wort wie Nebel über einer Insel
Avalon ist das sagenhafte keltische Elysium – ein „Land der Seligen“ jenseits der normalen Welt. Der Name wird meist auf keltisch/walisische Wörter rund um „Apfel“ bzw. „Apfelbaum“ zurückgeführt (sinngemäß: „Insel der Äpfel“), was gut zur Vorstellung eines fruchtbaren, heilenden Andersorts passt.
Der Legende nach wird König Artus nach seiner schweren Verwundung dorthin gebracht, um zu genesen (oder zu warten, bis seine Zeit wiederkommt). Avalon gilt als Ort von besonderer Magie: Dort wird Excalibur mit Artus verbunden, und in vielen Erzähltraditionen ist es die Insel der wunderbaren Apfelbäume – Symbol für Fülle und Unsterblichkeit. Als mächtige Herrscherin oder Hüterin Avalons erscheint oft die geheimnisvolle Morgana (Morgan le Fay).
Heutige Bedeutung: Heute steht „Avalon“ meist als Bild für einen Sehnsuchtsort: ein Rückzugsraum, an dem Heilung möglich ist, wo Dinge „wieder ganz“ werden – wörtlich in Fantasy, Musik und Popkultur, oft aber metaphorisch für innere Ruhe, Hoffnung und Neubeginn.
-
Etwas ist faul im Staate Dänemark

Etwas ist faul im Staate Dänemark – echt jetzt?
Die Redewendung "Etwas ist faul im Staate Dänemark" verdankt ihre Herkunft dem weltberühmten Stück "Hamlet" von William Shakespeare. Genauer gesagt, dem ersten Akt, Szene 4. Dort sagt der Charakter Marcellus zu Horatio: "Something is rotten in the state of Denmark". Zu Deutsch: "Etwas ist faul im Staate Dänemark".
Shakespeare veröffentlichte Hamlet im Jahr 1601. Die Geschichte dreht sich um den dänischen Prinzen Hamlet, der den plötzlichen Tod seines Vaters aufklären will. Der Ausspruch fällt zu einem Zeitpunkt, an dem bereits klar ist, dass im Königreich Dänemark dunkle Machenschaften und Verrat am Werk sind. Der Ausdruck "faul" steht hier symbolisch für etwas, das verrottet und verdorben ist – eine Andeutung auf die moralische Korruption und den Verfall, die das Königshaus heimsuchen.
Heutige Bedeutung: Wenn also "etwas faul im Staate Dänemark ist", dann vermuten wir Probleme oder Unangenehmes bzw. etwas, was nicht in Ordnung ist – sei es in der Politik, der Wirtschaft oder im persönlichen Umfeld. Der Satz wird auch in Situationen genutzt, in denen ein Verdacht aufkommt, dass nicht alles so ist, wie es scheint.
-
Fauxpas - Bedeutung, Herkunft und unmögliche Beispiele
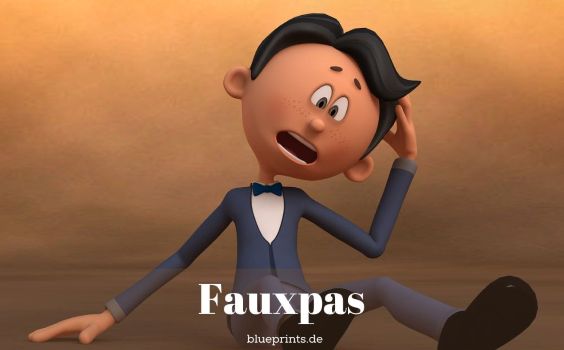
Fauxpas – Bedeutung, Herkunft und unmögliche Beispiele
Die Herkunft des Begriffs "Fauxpas" verdanken wir dem Französischen. Es setzt sich aus den Wörtern "faux" (falsch) und "pas" (Schritt) zusammen, was wörtlich "falscher Schritt" bedeutet.
Ursprünglich bezeichnete es einen tatsächlichen Fehltritt, wurde jedoch im übertragenen Sinne für gesellschaftliche Fehltritte verwendet. Im 18. Jahrhundert fand der Begriff Eingang in die deutsche Sprache.
Heutige Verwendung: Heutzutage versteht man unter einem Fauxpas einen unbeabsichtigten Verstoß gegen gesellschaftliche oder kulturelle Umgangsformen. Es handelt sich um eine Handlung oder Äußerung, die als unangemessen oder peinlich empfunden wird. Solche Fehltritte können von kleinen Peinlichkeiten bis hin zu schwerwiegenden Verstößen gegen soziale Normen reichen.
-
Jemandem nicht grün sein – Bedeutung und Herkunft

Jemandem nicht grün sein – Bedeutung und Herkunft
Der Ausdruck "Jemandem nicht grün sein" verdankt seine Herkunft der mittelalterlichen Farbsymbolik. Grün stand damals oft für Harmonie, Hoffnung und Fruchtbarkeit, aber auch für Neid und Missgunst. Die Farbe wurde häufig mit zwischenmenschlichen Beziehungen in Verbindung gebracht. Wenn man jemandem "nicht grün" war, bedeutete das also, dass keine harmonische Beziehung oder Sympathie bestand.
Ein anderer Erklärungsansatz verweist auf die mittelalterliche Heraldik. In Wappen stand die Farbe Grün oft für Loyalität oder Wohlwollen. War dieses "Grün" nicht vorhanden, konnte das auf Feindschaft hindeuten.
Heutige Bedeutung: Wenn wir "jemandem nicht grün sind", ist es ein höflicher Ausdruck für den Umstand, dass wir jemandem nicht gewogen sind. Wenn wir jemanden mögen, dann sind wir ihm also grün.
-
Gretchenfrage - Herkunft, heutige Bedeutung und Beispiele

Die Gretchenfrage: Eine kleine Frage mit großer Wirkung - Herkunft, heutige Bedeutung und Beispiele
Herkunft: Der Ausdruck "Gretchenfrage" geht zurück auf Johann Wolfgang von Goethes Tragödie "Faust I". In der Szene "Marthens Garten" stellt die junge Margarete, genannt Gretchen, dem Protagonisten Heinrich Faust die Frage:
"Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann,
Allein ich glaub', du hältst nicht viel davon."Diese Frage zielt direkt auf Fausts religiöse Überzeugungen ab und fordert ihn zu einem klaren Bekenntnis heraus. Da Faust einen Pakt mit dem Teufel, Mephisto, eingegangen ist, bringt ihn diese Frage in eine unangenehme Lage.
Heutige Bedeutung: Sie bezeichnet eine direkte, oft unangenehme Frage, die den Kern eines Problems trifft und den Befragten zu einem klaren Bekenntnis herausfordert. Solche Fragen werden häufig in politischen, ethischen oder persönlichen Diskussionen gestellt, um die wahren Überzeugungen oder Absichten einer Person offenzulegen.
-
Moloch - Bedeutung und Herkunft

Moloch - vom König zum Übeltäter
Die Herkunft des Begriffs verdanken wir dem Hebräischen „מֹלֶךְ“ (mōlek), was „König“ bedeutet. In der Bibel wird Moloch als Gottheit dargestellt, der Kinderopfer dargebracht wurden, insbesondere in den Kulturen der Kanaaniter und Phönizier. Diese Praxis wurde im Alten Testament streng verurteilt, etwa in Levitikus 20:2-5, wo das Opfern von Kindern an Moloch als Gräueltat beschrieben wird.
Heute wird er oft metaphorisch verwendet, um eine alles verschlingende Macht oder Institution zu beschreiben, die individuelle Opfer fordert. Beispielsweise bezeichnete der Dichter Allen Ginsberg in seinem Gedicht "Howl" Moloch als Symbol für die zerstörerischen Kräfte der modernen Gesellschaft .
-
Popanz Bedeutung
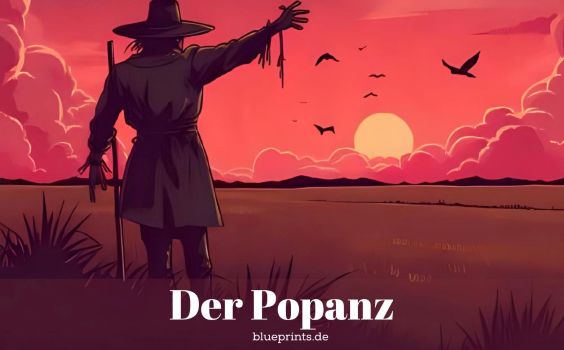
Popanz Bedeutung: Vom Schreckgespenst zur Redewendung
Das Wort "Popanz" verdankt seine Herkunft dem tschechischen Wort bubák (Schreckgespenst, Vogelscheuche) und bedeutet ursprünglich eine künstlich hergestellte Schreckgestalt, insbesondere eine ausgestopfte Puppe, die als Kinderschreck verwendet wurde. Seit dem 16. Jahrhundert ist das Wort in Deutschland gebräuchlich für Popelmann, Poppelhans (entstanden aus Puppe und Hans).
Heutige Bedeutung: Wenn wir der "Popanz" für jemanden sind, dann sind wir jemand, der alles mitmacht. "Ich bin doch nicht dein Popanz!" sagt man und meint, dass man doch nicht alles mit sich machen lässt.
Auch die Bedeutung "aufgeblasener Mensch, jemand, der sich groß tut, obwohl er wenig Substanz hat" ist belegt. (Manchmal im Sinne von "Pappkamerad" oder "Blendwerk")
Seite 2 von 2

